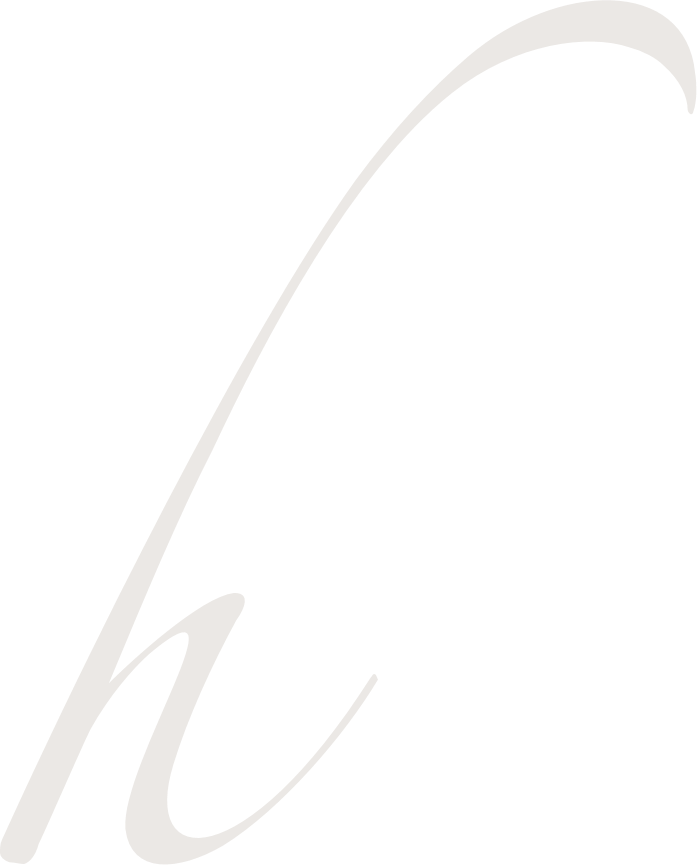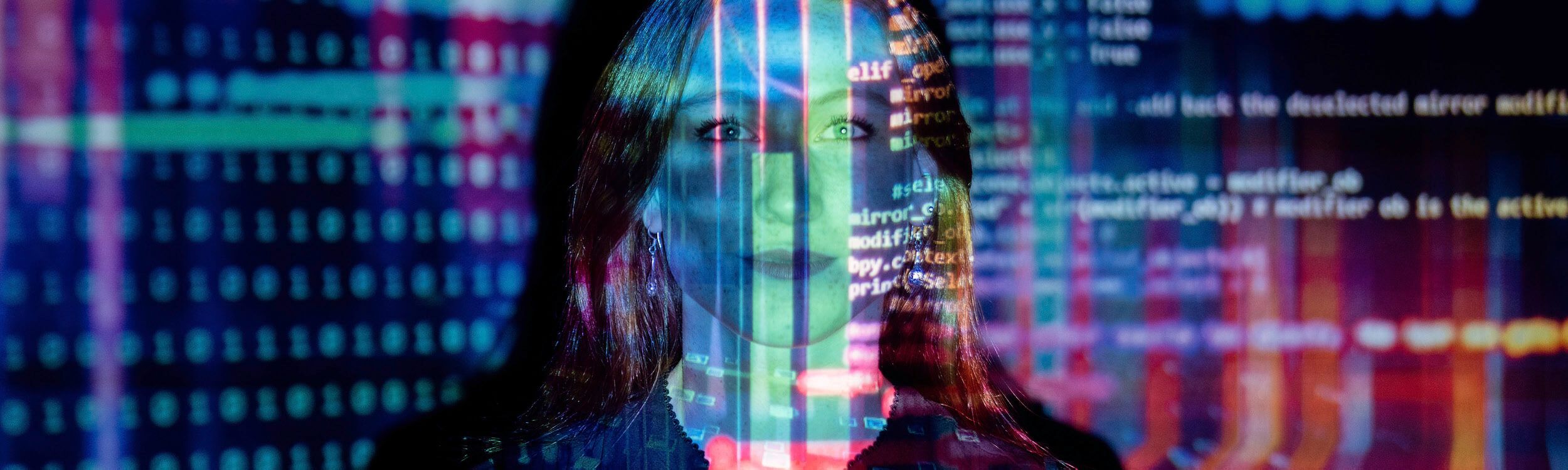
Das unabwendbare Scheitern einer talentierten Behörde
Die Erwartungen an die Finma sind riesig. Die Behörde versucht, ihre grosse Verantwortung durch eine exzessive Formalisierung tragbar zu machen. Zudem statuiert sie Exempel an kleineren Fischen, schont aber die grossen.
Stellen Sie sich folgendes vor: Ein grosses Wasserbecken mit 100 Haifischen und tausenden kleineren Fischen, darüber eine Tafel mit der Aufschrift: «Wir schauen, dass es allen gutgeht. Ihr Aufseherteam.» Als Zuschauer weiss man sofort, dass dennoch gelegentlich Fische von den Haien gefressen werden, selbst wenn sich das Aufseherteam alle Mühe gibt. Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht hat genau diese unmögliche Aufgabe gefasst. Auf ihrer Website steht: «Die Finma setzt sich für den Schutz der Gläubiger, Anleger und Versicherten sowie für den Schutz der Funktionsfähigkeit der Finanzmärkte ein.» Die Finma ist gewissermassen der verlängerte Arm des Staates, der alle vor allem Unbill schützen soll, was selbstredend unmöglich ist.
Dieser Anspruch ist verbunden mit steigendem Wohlstand, durch den sich viele nach Absicherung sehnen. Diesem gesellschaftlichen Trend hin zu weniger Eigenverantwortung folgt die Politik und somit der Gesetzgeber. Als Brandbeschleuniger dieser Entwicklung wirkte die globale Finanzkrise von 2007 bis 2009, als in der Schweiz viele Sparer Geld mit Finanzprodukten verloren haben und die UBS vom Staat gerettet werden musste. «Nie mehr wieder!», lautete danach die politische respektive gesetzgeberische Vorgabe und somit der Auftrag an die Finma.
Diese in Gesetze und Verordnungen gegossene Anspruchshaltung ist jedoch nicht realistisch. Dass der Staat Geldwäscherei und Finanzdelikte effizient bekämpft und Regeln für einen funktionierenden Finanzmarkt und stabile Banken setzt, ist unbestritten und wichtig. Der Gesetzgeber müsste aber das Pflichtenheft der Finma klarer begrenzen. Wie weit soll die Behörde gehen, um beispielsweise Anleger zu schützen? Der mündige Anleger braucht Zugang zu den nötigen Informationen; hier kann die Behörde mit der Pflicht zur Informationsbereitstellung zu Produkten und deren Kosten helfen. Die Finma will im Einklang mit dem europäischen Regulator aber mehr: Die Bank oder der Finanzberater sollen zum Schutz des Anlegers besser wissen als er selbst, welche Produkte zu seinem Wissensstand und seiner finanziellen Situation passen. So geht die Behörde von einem zu bevormundenden Anleger aus. Doch der Anleger wie auch der mündige Bürger können falsch entscheiden – das ist die Kehrseite der Entscheidungsfreiheit.
Exzessive Formalisierung
Die detailversessene Regulierung mit dem universellen Anspruch, sämtliche künftigen Fehlentwicklungen zu vermeiden, kann nicht funktionieren. Das Bestreben, die Verantwortung für die Finma und deren Mitarbeitende tragbar zu machen, führt zu einer exzessiven Formalisierung. Ob zum Beispiel ein Verwaltungsrat einer Bank «Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit» bietet, lässt sich einfacher anhand einer formalen Checkliste abarbeiten als durch eine inhaltliche Beurteilung der Fähigkeiten der betreffenden Person. Gemäss Checkliste sind sodann Lebenslauf, Zeugnisse, Arbeitsverträge und anderes einzureichen. Schliesslich ist das Fehlen eines Arbeitszeugnisses des -vorletzten Arbeitgebers viel leichter zu überprüfen als das Fehlen von Wissen.
Ob das Fachwissen des potentiellen Verwaltungsratsmitglieds überzeugt, hat schon die Findungskommission des Verwaltungsrates unter Zuhilfenahme von Assessmentprofis geprüft. Wie will die Behörde mehr wissen als die Vertreter der Eigentümer? Die formale Check-the-Box-Prüfung bringt nichts ausser Aufwand. Selbst fachlich kompetente Personen können kolossale Fehler machen, wie das Beispiel des Verwaltungsrates der Credit Suisse zeigt. Aus Sicht der Behörde ist die Formalisierung jedoch der Königsweg, da sich die Einzelpersonen bei der Beurteilung weniger exponieren müssen. Und das macht die Verantwortung tragbar: Man ist primär verantwortlich für das Einholen aller Dokumente gemäss Checkliste, nicht aber für die inhaltliche Beurteilung.
Neben der Formalisierung scheint es eine ungeschriebene Regel zu geben, wonach man Exempel in der kleinräumigen Schweiz an kleineren und nicht an den grossen Fischen statuiert. Im Mai 2014 bekannte sich die Credit Suisse in den USA der Beihilfe zur Steuerhinterziehung schuldig und bezahlte eine Busse von 2,8 Milliarden Dollar – die höchste Strafe, die dort je einer Firma für steuerrechtliche Vergehen aufgebrummt wurde. Konsequenzen in der Geschäftsführung oder dem Verwaltungsrat der Bank hatte dies nicht; die Finma sah die Gewähr für eine einwandfreie Geschäftsführung nach wie vor als gegeben.
Nicht so bei Andreas Waespi, der bis zum Sommer im selben Jahr CEO der Bank Coop war. Die Bank hatte von 2009 bis 2013 den Kurs der eigenen Aktie gestützt, was als Kursmanipulation ausgelegt wurde. Obschon keine persönliche Bereicherung stattfand, galt der CEO als Hauptverantwortlicher, und dieses Mal griff die Finma hart durch: Das im Oktober 2014 ausgesprochene Verdikt war ein Berufsverbot von drei Jahren sowie das erstmalige Publizieren des Namens eines Bestraften.
Samthandschuhe trug die Finma hingegen bei Urs Rohner: Er war ab 2004 Group General Counsel, wechselte 2009 in den Verwaltungsrat und war von 2011 bis 2021 Präsident des Verwaltungsrats der Credit Suisse. In seine Amtszeit fielen der erwähnte CS-Skandal, aber auch weitere wie jener um die heimliche Überwachung von Führungskräften. In seiner Amtszeit als Verwaltungsratspräsident gab der Aktienkurs um gegen 75 Prozent nach. Ein personelles Führungsproblem wollte die Finma jedoch über Jahre nicht sehen. Ruft man sich in Erinnerung, wie in anderen Fällen kleinere Fische grilliert wurden, fragt man sich, warum der Walfisch Credit Suisse weiterhin frei schwimmen durfte. Nach der Notübernahme der Credit Suisse durch die UBS wirkt das vorgebrachte Argument der fehlenden Kompetenzen vorgeschoben.
Abgrenzung von der allumfassenden EU-Regulierung
Was wäre also zu tun, um die Regulierung und Kontrolle, die es zweifellos braucht, zu verbessern?
- Sowohl der Gesetzgeber als auch die Finma müssen Abstand nehmen vom Gedanken, dass man alle vor allen Unwägbarkeiten schützen kann. Insbesondere nach dem zweiten Kollaps einer Schweizer Grossbank darf nicht noch mehr (über)reguliert werden; zu einer funktionierenden Marktwirtschaft gehört das Scheitern.
- Folglich muss sich die Schweiz dringend abgrenzen von der paternalistischen, allumfassenden EU-Regulierung und sich auf die wesentlichen Risiken konzentrieren. Verursacht werden diese in aller Regel oben in der Hierarchie und nicht bei den subalternen Funktionen.
- Es sind weniger, aber die richtigen Fragen zu stellen: Die Scheinsicherheit durch die hohe Formalisierung ist zu ersetzen durch eine – zugegebenermassen schwierige – inhaltliche Kontrolle. Mit dem Abhaken von Checklisten wird die Welt noch nicht besser.
- Der Regulator muss in gravierenden Fällen den Mut aufbringen, auch bei grossen Fischen durchzugreifen.
- Das Aussprechen von Massnahmen und das Durchgreifen müssen immer regelgebunden erfolgen. Hierzu müssen die beaufsichtigten Finanzinstitute auch niederschwellige Möglichkeiten haben, sich gegen als unsinnig empfundene Massnahmen zur Wehr zu setzen. Denn es ist stossend, dass beispielsweise die Rundschreiben der Finma Verordnungscharakter haben, aber keiner Vernehmlassung oder Kontrolle unterliegen. In einer Demokratie ist es problematisch, wenn sich einzelne Behörden die Spielregeln selbst vorgeben. Denn: Wer bewacht den Wächter?
Thomas Hauser
ist Managing Partner der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG in Baar.
- Interessenkonflikte