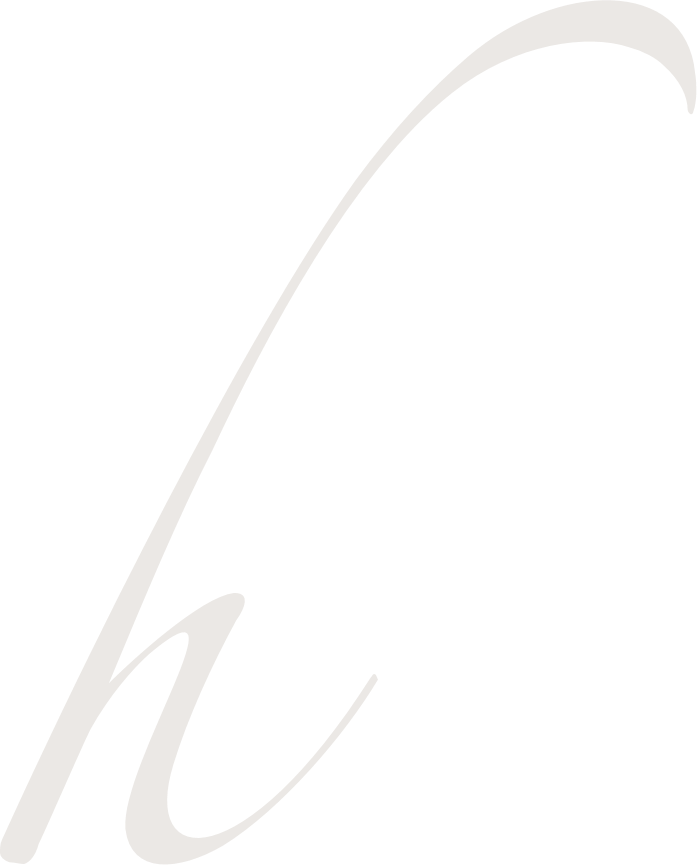Sieben Mythen der Vermögensverwaltung
Mythos Nr. 1: Das Benchmarking der Umsetzung der Anlagestrategie ist zentral
Das enge Überwachen der Anlageumsetzung mittels Benchmarks ist ein wichtiger Teil des Controllings, vor allem wenn es darum geht, Abweichungen – seien es positive oder negative – zu plausibilisieren und zu verstehen. Liegt ein Asset Manager bei der Umsetzung der vorgegebenen Strategie nachhaltig hinter dem Vergleichsindex, wird er ersetzt.
Wichtiger als die Umsetzungskontrolle wäre jedoch ein periodisches Strategie-Controlling. Denn wie bei den Asset Managern gilt es, die guten Consultants von den weniger guten zu unterscheiden. Dass die Wahl der richtigen Strategie wichtiger ist als die perfekte Umsetzung einer suboptimalen Strategie sei an einem Beispiel illustriert.

Zwei Pensionskassen mit identischer Risikofähigkeit gaben sich im Jahr 2004 eine neue Strategie und haben diese über die Jahre unverändert belassen. Während die PK Traditionell auf alternative Anlagen verzichtet, führt die PK Progressiv davon 15% in der Strategie. Die Umsetzungskosten bei der PK Progressiv sind wegen der Alternativen Anlagen mit 0,6% signifikant höher, denn sie betragen bei der PK Traditionell nur 0,15%.1
Heute, nach über zwanzig Jahren, stellt der Controller bei der Analyse erfreut fest, dass die PK Progressiv eine Outperformance nach Kosten von 0,1 Prozentpunkten p.a. aufweist; der Stiftungsrat feiert die gute Leistung. Ganz anders ist die Stimmung bei der PK Traditionell; man beklagt eine Underperformance von –0,1 Pp p.a. Die gedrückte Stimmung herrscht jedoch zu Unrecht, denn die Strategie der PK Traditionell ist überlegen. Deren gute Strategie überkompensiert die suboptimale Umsetzung!

Das Vermögen von ursprünglich 100 Mio. Fr. wächst bei der PK Progressiv – unter Ausklammerung von Zu- und Abflüssen – auf knapp 256 Mio. Fr. Bei der PK Traditionell sind es jedoch 16 Mio. Fr. oder 6% mehr. Es ist besser, die richtige Route zu wählen, als auf dem falschen Weg perfekt zu navigieren! Dennoch machen interessanterweise die wenigsten institutionellen Investoren ein so stringentes Strategie-Controlling wie sie die Umsetzung überwachen.
Mythos Nr. 2: Das passive Anlegen senkt die Vermögensverwaltungskosten
Fakt ist, dass die Vermögensverwaltungskosten bei den traditionellen Anlagen in den letzten Jahren gesunken sind. Zudem ist es ein Fakt, dass die Kosten den Anlagestils «indexiert» im Mittel unter jenen von aktiv verwalteten Mandaten liegen. Der Anteil dieser günstigeren Indexanlagen am Gesamtvermögen der Schweizer Pensionskassen hat in den letzten zehn Jahren von 22 auf 31% zugenommen.2
Demnach würde man erwarten, dass auch die gesamten Vermögensverwaltungskosten bei den Pensionskassen gesunken sind. Das Bild dazu ist jedoch nicht einheitlich: Während die Beratungsgesellschaft c-alm in einer Studie auf eine Kostenreduktion hinweist – von 0,56% im Jahr 2011 auf 0,48% im Jahr 2019 –, stellt die Beratungsgesellschaft PPCmetrics in den Jahren von 2014 bis 2023 unveränderte Vermögensverwaltungskosten fest.3 Letztere findet interessanterweise in der grossen Gesamtvermögensspanne von 5 Mio. bis 40 Mrd. Fr. keinen Zusammenhang zwischen Vermögensverwaltungskosten und Vermögensgrösse! Auch die jüngsten Zahlen bestätigen dies.4
Was sind die Gründe? Paradoxerweise hat das Indexieren der Kernanlagen wie Aktien und Anleihen viele institutionelle Investoren dazu verleitet, vermehrt aktive und teils sehr teure Satelliten wie Infrastruktur, Rohstoffe, Hedge Funds oder Private Equity beizufügen. Offenbar werden dadurch die Kosteneinsparungen bei den Kernanlagen zunichtegemacht. Im Mittel liegen die Vermögensverwaltungskosten einer Strategie mit Alternativen Anlagen bei 0,66% und ohne bei 0,31%.5 Somit liegt der Hebel für Kostensenkungen nicht bei der Indexierung, sondern beim Verzicht auf Alternative Anlagen!
Mythos Nr. 3: Das passive Anlegen reduziert die Risiken
Korrekt ist, dass das indexierte Anlegen das relative Risiko reduziert. Das heisst, das Anlageergebnis weicht kaum von der Rendite der gewählten Benchmark ab. Das ist bequem für alle Beteiligten, weil «der Markt» für das Ergebnis verantwortlich ist und sich niemand mit Entscheiden exponieren muss. Das absolute Risiko – mögliche Vermögensschwankungen oder gar Verluste – muss jedoch mit aktiven Entscheiden zur Strategie- und Benchmarkwahl sowie zur Portfoliostruktur gesteuert werden.
Ein Beispiel: Wenn ein Investor entscheidet, die Aktien passiv abzubilden, müsste er sich an die Kapitalisierungsgewichte eines Weltaktienindex halten. Das bedeutet, dass die Schweiz ein Gewicht von rund 2% und jenes der USA von über 70% hätte. Letzteres lag vor wenigen Jahren noch bei rund 50%.
Das teils höhere absolute Risiko von indexierten Anlagelösungen hat die Ursache im inhärent prozyklischen Verhalten. Klumpenrisiken können die Folge davon sein: Branchen, wie Technologie Ende der Neunzigerjahre und heute, oder Länder, wie Japan Ende der Achtzigerjahre und die USA heute, können Gewichte annehmen, die den Grundsätzen der Diversifikation widersprechen.
Gleiches gilt bei den Anleihen. Im Zuge der niedrigen Zinsen ist die Laufzeit im Swiss Bond Index nach 2009 um 40% gestiegen. Der passive Investor akzeptierte somit die Laufzeitentscheide der Emittenten und damit ein höheres Zinsänderungsrisiko.
Mythos Nr. 4: Zusätzliche Anlagekategorien verbessern die Diversifikation
Seit der Jahrtausendwende hat die Anzahl der Anlagekategorien massiv zugenommen. Zum einen sehnten sich die Investoren nach den leidvollen Erfahrungen der Dotcom- und Finanzkrise nach «stabileren» Anlagen, zum anderen mussten die Anbieter unter dem Druck der Margenerosion bei den traditionellen Anlagen neue Angebote erschliessen. Das Marketingversprechen lautet, dass insbesondere die Alternativanlagen wie Private Equity, Infrastruktur, Hedge Funds oder Rohstoffe die Diversifikation verbessern sollen, da es sich um «alternative Risikoprämien» mit anderen Zyklen handle.
Eine Untersuchung anhand der Allokation der durchschnittlichen Schweizer Pensionskasse6 ist erhellend und ernüchternd zugleich. Es werden die 10% der Allokation, die auf Alternative Anlagen entfallen, so auf Franken-Obligationen und Aktien Schweiz umverteilt, dass unter Verwendung von Daten über zwanzig Jahre entweder dieselbe Rendite oder dasselbe Risiko wie bei der Allokation mit alternativen Anlagen anfällt. Es zeigt sich, dass die Varianten ohne Alternative Anlagen effizienter sind:

Bei illiquiden Anlagen wie Private Equity oder Infrastruktur scheinen die Schwankungen nur geringer, weil es keine dauernd beobachtbaren Marktpreise gibt. Die ökonomischen Verlustrisiken sind deshalb nicht geringer; die meisten Alternativen Anlagen unterliegen den gleichen ökonomischen Zyklen. Mit traditionellen, liquiden, transparenten und somit auch günstigeren Anlagekategorien kann man langfristig effizientere Portfolios bauen.
Es braucht zwar eine gewisse Diversifikation; das «blinde» Hinzunehmen aller möglicher Anlagekategorien ist aber nicht zielführend. Entscheidend ist, dass die berücksichtigten Anlagekategorien über eine mit öffentlichen Daten belegte Renditeevidenz verfügt.
Mythos Nr. 5: Balanced Mandate sind nicht mehr «State of the Art»
Kategorienmandate, also einzelne Mandate für Aktien Schweiz, Aktien Welt, Franken-Anleihen etc., werden oft mit dem Argument vergeben, man können dadurch für jede Anlagekategorie einen Spezialisten mandatieren. Balanced Mandate, also wenn das gemischte Mandat alle in der Anlagestrategie enthaltenen Anlagekategorien umfasst, spielen in der Praxis bei Pensionskassen bis zu 1 Mrd. Fr. Gesamtvermögen aber nach wie vor eine gewichtige Rolle.7

Dieses Bedeutung ist nicht ohne Grund, verfügen die gemischten Mandate doch über zahlreiche Vorteile:
- Bei gemischten Mandaten setzen innerhalb einer (Vorsorge-)Stiftung alle Asset Manager die gleiche Strategie um und sind vergleichbar.
- Da beim Einsatz von Mischmandaten das Gesamtvolumen auf weniger Mandate verteilt wird als bei Kategorienmandaten, sind sie in der Regel grösser und können aufgrund der degressiven Gebührenstruktur einen signifikanten Kostenvorteil bringen.
- Die geringere Anzahl von Mischmandaten im Vergleich zu Kategorienmandaten führt auch zu geringeren Kosten für die Manager-Suche und Controlling. Ein Schelm, wer den Umkehrschluss zieht: Die zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten für Berater könnte auch ein Grund für die Vorliebe von Kategorienmandaten sein.
- Der Asset Manager hat in der Verwaltung mehr Freiheitsgrade, weil er auch die Kategoriengewichte steuern kann.
Darüber hinaus können in sehr grossen Stiftungen, die mehrheitlich Kategorienmandate führen, Mischmandate zwecks Live-Benchmarking eingesetzt werden: Ist die Summe der spezialisierten Kategorienmandate besser als die Umsetzung der Strategie mittels Mischmandat?
Mythos Nr. 6: Der Einsatz von Investment Consultants führt zu besseren Anlageergebnissen
Investment Consultants unterstützen Pensionskassen, Stiftungen und Unternehmen bei der Strategiewahl, der Wahl des Stils (aktiv oder indexierte Anlage) und der Umsetzung, insbesondere bei der Selektion der Asset Manager. 73% der Pensionskassen ziehen Strategieberater bei.8 Die Investment Consultants standardisieren Prozesse; das führt zu einer Eliminierung der Extreme. So können die ganz schlechten Ergebnisse durch schlechte Strategien, Umsetzungskonzepte oder Asset Manager vermieden werden. Der Preis dafür ist jedoch, dass auch die besten Ergebnisse verhindert werden.
Das «Einmitten» der Anlageergebnisse ist aus Sicht der Berater rational, weil die Sicherung der Reputation dies erfordert. Letztlich führt es zu einem Hang der Berater zum passiven Anlagestil: Man vergibt zwar Chancen damit, verhindert aber auch Debakel. Interessant dabei ist eine Darstellung der Beratungsgesellschaft PPCmetrics zu Fünf-Jahres-Renditen von Managern für Aktien Schweiz Mandate.9

Es zeigt sich, dass aktiven Mandate zu den schlechtesten und besten gehören, die passiven Mandate sind eingemittet – ganz nach dem Gusto der Consultants.
Kennt ein Anlageausschuss respektive Investor diese Einmittungstendenz der Consultants, will aber nicht auf die exzellenten Anlagelösungen und Asset Manager verzichten, muss er sich bei Ausschreibungen (Asset Manager Searches) und der Auswahl einbringen und Vorgaben machen. So ist es vermutlich nicht zielführend, wenn bei Fragebögen für Ausschreibungen beispielsweise nach der Anzahl Bürostandorte gefragt wird, nicht aber nach bezahlten Bussen oder Gerichtsverfahren. Darüber hinaus sind persönliche Befragungen und das Einholen von Referenzen zwar sehr aufwändig, aber bei der Suche nach Exzellenz unverzichtbar. Das Abfüllen standardisierter Fragebögen alleine reicht nicht, wenn man nicht nur den Standard finden will.
Die Beratungsindustrie – sei dies bei den Finanzen oder in anderen Branchen – muss zwangsweise eine gewisse Komplexität der Materie aufrechterhalten, selbst wenn sich diese vereinfachen liesse. Denn Komplexität schafft Abhängigkeiten und Abhängigkeiten sind künftige Einnahmen. Eingedenk dessen sollte sich ein Anlageausschuss respektive Investor stets für simple Lösungen einsetzen – das spart langfristig Geld und verbessert die Anlageergebnisse.
Mythos Nr. 7: Aktive Manager sind Trader – hin und her macht Taschen leer
Es ist in der Tat so, dass ein grosser Teil der aktiven Manager die eigene Prognosekompentenz massiv überschätzt. Dies führt oft zu sehr aktivem Handeln. Dieses Trading hat immer Kostenfolgen, führt aber weniger oft zum Renditeerfolg. Das Resultat ist der gut dokumentierte Befund, dass ein Grossteil der aktiven Asset Manager keinen Mehrwert bringt.10 Hin und her macht Taschen leer – das ist insbesondere ein Problem, wenn Asset Manager oder Banken am Handelsumsatz mitverdienen; es bestehen dann offenkundige Fehlanreize. In der Praxis gibt es aber das zweite Problem der Prozyklizität: Rennt man hinterher, macht dies auch die Taschen leer.
Aktives Management basierend auf Renditeprognosen ist in der heutigen Welt effizienter Märkte meist ein Rohrkrepierer. Wenn aktives Management jedoch als Risikomanagement und antizyklische Steuerung verstanden wird, kann es langfristig durchaus einen Mehrwert bringen. Es geht letztlich darum, aktive Strukturentscheide in einem Portfolio zu treffen: Wie lang darf die Duration bei Anleihen sein, was ist der maximale Anteil von Branchen oder Ländern, braucht es auf Titelebene Gewichtsbeschränkungen etc.? So können übermässiges Handeln, Klumpenrisiken und eine zu prozyklische Portfolioentwicklung vermieden werden.
Wie auf der Stufe der Aktienauswahl zu viele Wechsel unnötige Kosten verursachen, gilt dies auch auf Stufe der Asset-Manager-Auswahl. Daher muss der Investor klar definieren, welche Eigenschaften ein aktiver Manager haben soll. Wenn er eine Auswahl sorgfältig und mit Überzeugung trifft, muss er ihm auch genügend Zeit schenken. So ist beispielsweise eine Performancebeurteilung über zwei Jahre zu kurz. Ohne die erforderliche Geduld kann es bei der Asset-Manager-Auswahl zu einem Aktionismus kommen, der zu unnötigen Kosten führt. Oder frei nach Benjamin Graham: «Geduld ist die oberste Tugend des Investors».
Quellen und weiterführende Literatur:
- Datengrundlage gemäss Thomas Hauser, «Core-Satellite-Ansatz als Rohrkrepierer», Schweizer Personalvorsorge, Mai 2024.
- Swisscanto, «Pensionskassen Studie», 2023, S. 39
- c-alm, «Vermögensverwaltungskosten in der 2. Säule», 2019, S. 15; PPCmetrics, «Sinken Vermögensverwaltungskosten in Zukunft weiter oder ist die Talsohle erreicht?», Mai 2024, S. 11
- PPCmetrics, Pensionskassen-Jahrbuch, 2025, S. 31
- Bei einer Allokation gemäss UBS Pensionskassenindex; vergleiche dazu Thomas Hauser, «Core-Satellite- Ansatz als Rohrkrepierer», Schweizer Personalvorsorge, Mai 2024
- Thomas Hauser, «Core-Satellite-Ansatz als Rohrkrepierer», Schweizer Personalvorsorge, Mai 2024
- Swisscanto, Pensionskassenstudie 2025, S. 42
- Swisscanto, Pensionskassenstudie 2025, S. 30
- Dr. Hansruedi Scherer, Lukas Riesen und Shakitthiyan Vettimayilnathan, «Umsetzung Aktien: Wo lohnt sich aktives Management?», Präsentation, 3. Oktober 2024
- Siehe beispielsweise Busse Jeffery A. et al.: Performance and persistence in institutional investment management, The Journal of Finance, Vol. LXV, No. 2, p. 765-790, 2010; oder Goyal Amit und Sunil Wahal.: The selection and termination of investment management firms by plan sponsors, «The Journal of Finance», Vol. LXIII, No. 4, p. 1805- 1847, 2008
Dr. Thomas Hauser
Thomas Hauser ist geschäftsführender Partner bei der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG. Zuvor arbeitete er u.a. als Senior Investment Consultant und Teamleiter bei PPCmetrics sowie im Finanzmarkt- und Volkswirtschafts-Research der Credit Suisse in Zürich. Nach dem Studium an der Universität Basel mit Vertiefungsrichtung Finanzmarkttheorie und Ökonometrie sowie einem Nachdiplomstudium an der Universität Lausanne (Abschluss als MSc in Banking and Finance) erwarb er an der Universität Basel seinen Doktortitel auf dem Gebiet der strategischen Asset Allocation.
- Aktiv vs Passiv
- Alternative Anlagen
- Diversifikation
- Interessenkonflikte
- Langfristig