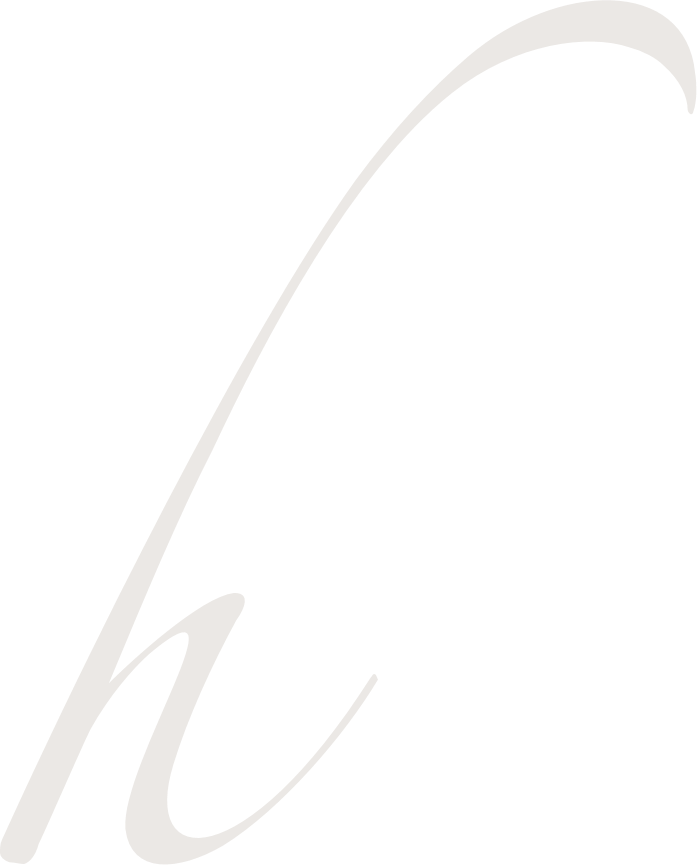Die tickende Zeitbombe an den Finanzmärkten
Während sich Anleger an Kriege und Trumps Zollchaos gewöhnt haben, wächst eine viel grössere Gefahr: Die weltweite Staatsverschuldung erreicht astronomische Höhen. Warum diese Entwicklung gefährlicher ist als alle aktuellen Schlagzeilen.
Wer die täglichen Schlagzeilen verfolgt, kommt unweigerlich zum Schluss, dass der Krieg in der Ukraine, der Gaza-Konflikt und die Zollpolitik der Vereinigten Staaten von Amerika die grössten Probleme sind, welche die Welt bewegen. Dem menschlichen Leid zum Trotz scheint der Einfluss dieser Krisenherde auf die Finanzmärkte erstaunlich bescheiden zu sein.
An die kriegerischen Ereignisse haben sich die Anleger längst gewöhnt, und auch die anfängliche Panik der Börsianer auf die Ankündigung des erratischen Zollregimes durch US-Präsident Donald Trump ist verflogen. Es scheint sogar, als ob die Investoren den Möchtegern-Diktator gar nicht mehr ernst nehmen würden.
Staatsverschuldung geht durch die Decke
Ein Indiz dafür ist der Freitag, 1. August, als die Schweizer Börsen feiertagsbedingt geschlossen waren. Als Trump eine Executive Order mit umfassenden Zollerhöhungen auf Importe aus 68 Ländern sowie der EU unterzeichnete, rechneten viele Auguren damit, dass die Schweizer Börse am darauffolgenden Montag um 10 bis 15% in die Tiefe rauschen würde.
Der Kurssturz blieb aus. Schweizer Aktien schlossen etwa auf Vortagesniveau, trotz aufoktroyierter Zölle von unappetitlichen 39%. Offensichtlich ist es aus Anlegersicht pure Zeitverschwendung, sich mit irrwitzigen Politikern zu beschäftigen.
Eine potenziell ungleich grössere Belastung, die auf die Finanzmärkte zukommen dürfte, liegt in der weltweiten Staatsverschuldung. Politiker hüben wie drüben übertrumpfen sich mit ihrer frivolen Ausgabenpolitik, als ob es kein Morgen geben würde.
Ausgabenweltmeister sind die Japaner, deren Schulden die astronomische Höhe von 240% des Bruttoinlandprodukts (BIP) erreichen. In Europa ist die Verletzung der Maastricht-Kriterien, die eine maximale Neuverschuldung von 3% und eine Schuldenobergrenze von 60% des BIP vorsehen, zur Normalität geworden. In Frankreich erreicht die Verschuldung 116%, im Belpaese gar 135%.
«Ein exzessiv verschuldeter Staat kann sich hohe Zinsen schlicht nicht leisten, wie das Beispiel Japan zeigt.»
Als grösstes Sorgenkind entpuppen sich zunehmend die USA, deren Verschuldung bei 120% steht und zügig weiterwächst. Dass die Amerikaner in einer konjunkturellen Hochphase abenteuerliche Defizite von jährlich 7% ausweisen, macht die Sache noch schlimmer.
Als Trump im April seine Zollpläne verkündete, erlebten die Amerikaner ihren «Liz-Truss-Schock». Die Preise von Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps) auf Treasury Bonds schossen in die Höhe und der Präsident musste sein Vorhaben auf Eis legen.
Nicht nur in den USA, auch in Japan, Grossbritannien und Frankreich sind die Zinsen langfristiger Anleihen in den letzten Jahren deutlich gestiegen, was auf ein angekratztes Vertrauen der Investoren hindeutet.
Wie bereits die europäische Staatsschuldenkrise vor über zehn Jahren gezeigt hat, erweist sich die unselige Verknüpfung von Staaten mit Banken und Versicherungen als tickende Zeitbombe.
Die Finanzinstitute halten gewaltige Bestände «risikoloser» Staatsanleihen in ihren Büchern. Wenn Ratingagenturen die Bonität der Papiere herunterstufen, schmelzen ihre Eigenmittel wie Schnee an der Sonne.
Unabhängigkeit der Notenbanken gefährdet
Ein exzessiv verschuldeter Staat kann sich hohe Zinsen schlicht nicht leisten, wie das Beispiel Japan zeigt. Seit vielen Jahren hält Nippon die Zinsen künstlich tief. Das führt zu einer massiven Abwertung des Yen und zu brandgefährlichen Spekulationsgeschäften mit billigem Geld (Carry Trades).
Auch Trump versucht mit aller Kraft, die US-Notenbank Fed zu drastischen Zinssenkungen zu zwingen, um den Dollar abzuwerten und den Staatshaushalt zu entlasten.
Fed-Chef Jerome Powell hält seinem Druck bisher wacker stand. Abzusehen ist jedoch, dass seine Nachfolge im Mai 2026 Trump-konform geregelt wird, was forcierte Zinssenkungen zur Folge haben könnte.
Unter dem Druck der Regierungen haben die Notenbanken hoch verschuldeter Länder schlicht keine Alternative, als durch finanzielle Repression die Zinsen tief zu halten und diese unter die Inflation zu drücken – zum Schaden der Sparer, die auf realer Basis schleichend enteignet werden.
Eine ausufernde Staatsverschuldung und der Zwang, die Zinsen tief zu halten, führt die Notenbanken in eine Zwickmühle. Ihre Unabhängigkeit von der Politik ist gefährdet.
«Eine über längere Zeit lockere Geldpolitik führt zu Blasenbildungen und irrationalen Auswüchsen an den Finanzmärkten.»
Eine über längere Zeit lockere Geldpolitik führt zu Blasenbildungen und irrationalen Auswüchsen an den Finanzmärkten. Sie fördert einen Boom in Anlagen wie Bitcoin, der kein produktives Kapital verkörpert, keinen intrinsischen Wert aufweist und weder eine Dividende noch einen Zins bezahlt.
Bizarre Blüten treiben auch Meme-Coins wie Dogecoin oder Shiba Inu, deren Existenz allein auf der Spekulationswut gieriger Investoren beruht. Social-Media-Communities befeuern mit billigem Geld die Kurse von Anlagen, die oft illiquide sind und einfach manipuliert werden können.
Exzesse sind überdies im Kontext des KI-Booms und bei gewissen Tech-Aktien auszumachen. Auch die Hausse von Gold, Silber und Platin wäre ohne eine lockere Geldpolitik kaum möglich geworden, ebenso der Boom riskanter Privatmarktanleihen (Private Debt).
Dieser erinnert an den «Junk-Bond-König» Michael Milken, der in den Achtzigerjahren an Wallstreet mit hochverzinslichen Anleihen Berühmtheit erlangte, bevor das Kartenhaus zusammenbrach.
Signale einer potenziell aufflammenden Krise kommen wiederum aus den USA, wo die Regionalbanken Zions und Western Alliance sowie der Bankrott zweier milliardenschwerer Zulieferer der Automobilindustrie, First Brands und Tricolor, für Verunsicherung sorgen.
Die Stunde der Wahrheit
Auch die Immobilienpreise befinden sich in vielen Ländern der Welt in luftigen Höhen. Das schweizerische Hypothekarvolumen von über 130% im Verhältnis zum BIP bedeutet Weltrekord.
Ein markant höheres Zinsniveau und als Folge davon eine Immobilienkrise wie anfangs der Neunzigerjahre, als in der Schweiz Wohn- und Gewerbeliegenschaften zwischen 30 und 50% an Wert verloren, würden wohl nicht nur zahlreiche Hausbesitzer, sondern auch viele kreditgebende Banken in die Bredouille bringen.
Die Stunde der Wahrheit wird kommen, wenn die Konjunktur kippt, Unternehmen weniger verdienen und folglich weniger Steuern bezahlen. Zinssenkungen sind dann kaum noch möglich, weil das Ausgangsniveau schon zu tief ist.
Ebenso werden die Staaten kaum mehr stimulierende Konjunkturprogramme lancieren können, weil ihre Kassen klamm sind und die Investoren zunehmend das Vertrauen in Staatsanleihen verlieren.
Die Symbiose einer verantwortungslosen Staatsschuldenpolitik und einer notorisch lockeren Geldpolitik ist die Mutter aller Blasen und Krisen. Es ist der sprichwörtliche Ritt auf der Rasierklinge.
«Trotz vieler Baissen erzielten Schweizer Aktien über die letzten hundert Jahre eine Rendite von jährlich attraktiven 7,7%.»
Aus Sicht der Anleger stellt sich die Frage, ob sie aus Angst vor einer Krise und einem Börsensturz ihre Aktien verkaufen sollten. Davon ist aus zwei Gründen abzuraten.
Erstens sind Aktien der bessere Krisenschutz als Guthaben gegenüber Staaten und Banken, die in grossen Krisen oft bankrott gehen. Trotz vieler Baissen erzielten Schweizer Aktien über die letzten hundert Jahre eine Rendite von jährlich attraktiven 7,7% auf nominaler und 5,6% auf realer Basis.
Zweitens ist das Timing von Krisen nicht vorhersehbar. Bei der CS war der «harmlose» Tweet eines australischen Journalisten ein Auslöser des Untergangs, bei der Eurokrise ging die Brandursache vom weltweit bedeutungslosen Griechenland aus.
Welcher Funke die nächste Krise auslösen wird und wann, wissen nicht einmal die Götter, höchstens vielleicht die notorischen Untergangsapologeten.
Dr. Pirmin Hotz
Pirmin Hotz ist Gründer und Inhaber der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG mit Sitz in Baar.
- Diversifikation
- Prognosefähigkeit
- Langfristig