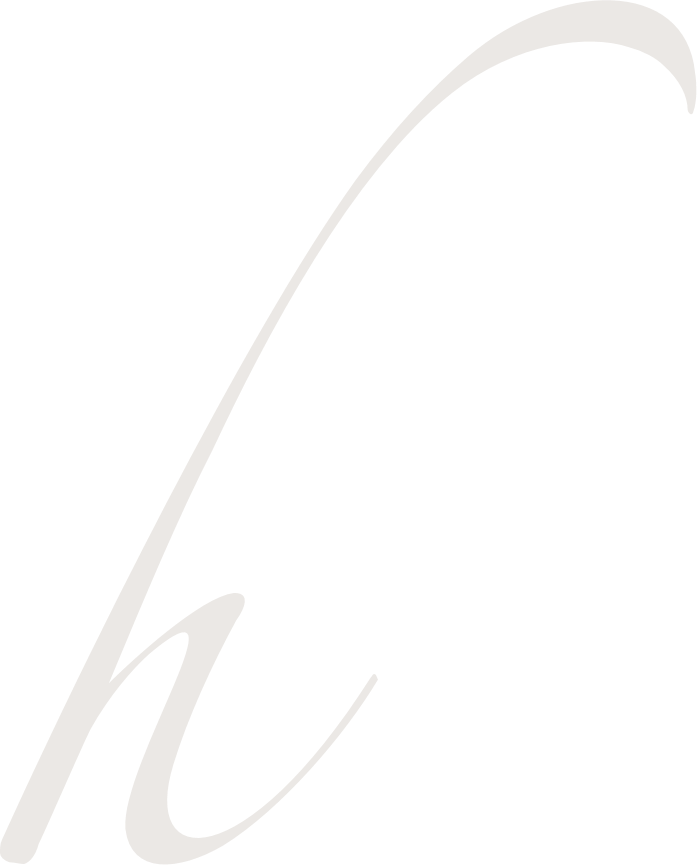Der Dollar ist überbewertet
Die vergleichsweise hohen Zinsen in den USA machen Anlagen im Greenback attraktiv. Doch er ist nunmehr deutlich zu hoch bewertet und demgemäss absturzgefährdet.
Die amerikanische Notenbank Federal Reserve unter der Führung ihres Präsidenten Jerome Powell geht das Problem der hohen Teuerung konsequent an. Sie hat die Leitzinsen in mehreren Schritten auf 3 bis 3,25% erhöht. Weitere Schritte dürften folgen.
Die Zinswende in Amerika hat zu einem markanten Zufluss von Geldern in den Dollar geführt, sodass er gegenüber dem Franken sogar wieder die Parität erreicht hat. Wir erinnern uns: Im August 2011 fiel der Dollar unter 71 Rappen auf seinen historischen Tiefstkurs, und nicht wenige Experten prognostizierten damals, dass er schon bald unter 50 Rappen sinken würde. Es herrschte Untergangsstimmung für die amerikanische Valuta.
Die düsteren Prognosen haben sich nicht bestätigt. Der Dollar hat seither seine Position als weltweite Leitwährung verteidigt. In diesem Jahr überbieten sich die Währungsanalysten geradezu mit euphorischen Prognosen und orakeln einen weiter steigenden Dollar herbei. Auszuschliessen ist eine solche Entwicklung nicht. So begründen die Protagonisten die Dollarstärke damit, dass die amerikanische Notenbank die Zinsen am aggressivsten erhöhen würde und hohe Zinsen attraktiv für Investoren seien.
Aber stimmt dieser Zusammenhang tatsächlich? Bei Lichte betrachtet ist die These, dass hohe Zinsen mit einer starken Währung einhergehen, ein geradezu abenteuerliches Märchen.
«Der Greenback hat handelsgewichtet den höchsten Wert seit mehr als zwanzig Jahren erreicht.»
Riskante Carry Trades
Jeder erfahrene Schweizer Anleger weiss, dass die Verlockungen in der Welt der Devisen schon immer gross waren. Wer sein Geld in ausländische Währungen wie Dollar, Euro, Pfund oder südafrikanische Rand statt in niedrig verzinsliche Franken investiert, erhält zwar dauerhaft einen höheren Zins, doch selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um einen Free Lunch.
Den Preis für den höheren Zins bezahlen die Investoren in der langen Frist mit happigen Währungsverlusten. So hat der Dollar in den knapp fünf Jahrzehnten seit der Aufhebung der fixen Wechselkurse im Jahr 1973 (der Kurs lag damals bei 4.30 Fr.) mehr als drei Viertel seines Werts verloren, während das Pfund (es lag bei 12.20 Fr.) sich sogar über 90% abgewertet hat.
In Ländern, in denen die Zinsen hoch sind, ist naturgemäss auch die Inflation hoch. So liegt die Teuerung in Ländern wie der Türkei, Argentinien oder Venezuela bei 80 oder gar 500%. Entsprechend hoch ist auch das Zinsniveau. Sind deswegen die türkische Lira, der argentinische Peso oder der venezolanische Bolívar langfristig attraktiv für Schweizer Investoren? Natürlich stellt sich diese Frage rein rhetorisch, denn diese Währungen von Ländern mit notorisch galoppierenden Inflations- und Zinsraten werten sich in der langen Frist zum steinharten Franken ab - notabene in der Höhe der Inflations- bzw. Zinsdifferenz. Was Investoren an Zinsen zusätzlich einnehmen, verlieren sie in der Währung.
Das entspricht nichts anderem als der Zinsparitätstheorie. Wäre dem nicht so, ergäbe sich für Investoren eine perfekte Arbitragestrategie, ohne jedes Risiko Geld zu verdienen: Man verschulde sich in der niedrig verzinslichen Währung Franken und lege das Geld im höher verzinslichen Peso an.
Genau diese Irrmeinung ist Tausenden von naiven Häuslebauern in Polen und Ungarn, die ihre Wohnung oder ihr Haus in Zloty oder Forint gekauft und ihre Hypothek im niedrig verzinslichen Schweizer Franken aufgenommen hatten, zum Verhängnis geworden. Sie erleben ein finanzielles Fiasko, weil sie zur Rückzahlung ihrer Schulden, die aufgrund der Frankenstärke geradezu explodiert sind, mehr als doppelt so viele Zloty oder Forint aufwenden müssen und der Wert ihres Immobilienobjekts den Kredit bei weitem nicht mehr deckt.
Wer Kredite in einer niedrig verzinslichen Währung wie dem Franken aufnimmt und in höher verzinsliche Währungen anlegt, macht sogenannte Carry-Trade-Geschäfte. Sie sind bei Hedge Funds im derzeitigen Umfeld besonders beliebt. Sie nehmen günstige Kredite in Franken oder japanischen Yen auf, um sie im attraktiv verzinsten Dollar anzulegen. Als Folge davon befinden sich die offenen Devisenterminspekulationen auf rekordhohem Niveau. Schon in der Vergangenheit haben sich unzählige Spekulanten mit solchen Hebelwetten kolossal die Finger verbrannt. Das wird diesmal kaum anders enden.
Der Greenback hat auf handelsgewichteter Basis den höchsten Wert seit mehr als zwanzig Jahren erreicht und ist mittlerweile deutlich überbewertet. Das zeigt sich an der Kaufkraftparität, die die Preise relevanter Konsumgüter einzelner Länder vergleicht und einen Anhaltspunkt für den fairen Wechselkurs liefert. Folgt man den Berechnungen von Bloomberg, Wellershoff & Partner sowie UBS, ergibt sich im Mittel ein fairer Dollarkurs von weniger als 80 Rappen - der Dollar ist somit gemäss Kaufkraftvergleichen rund 20% überbewertet. Besonders krass ist die Überbewertung gegenüber dem japanischen Yen. Sie beträgt schier unglaubliche 80 bis 90%, was historisch einmalig ist. Da die japanische Zentralbank keinerlei Absichten bekundet, ihre langjährige Niedrigzinspolitik zu lockern, ist der Yen als Spekulationsobjekt besonders begehrt. Unzählige Hedge Funds haben sich zum Nulltarif in Yen verschuldet, um den Gegenwert zu einem Zins von 3 bis 4% in Dollar anzulegen. Das sind gefährliche Wetten, die sich früher oder später rächen werden, denn inflationsbereinigt ist der Yen so schwach wie seit fünfzig Jahren nicht mehr.
Wer argumentiert, der Dollar müsse aufgrund der höheren Inflation und des höheren Zinses weiter steigen, denkt kurzfristig. Langfristig wird das Gegenteil der Fall sein. Die Empirie zeigt eindrücklich, dass Währungskurse zwar immer wieder zu Übertreibungen neigen, langfristig aber aufgrund des internationalen Güter- und Dienstleistungswettbewerbs um die Kaufkraftparität schwanken. Es ist deshalb eine Frage der Zeit, bis der Trend des steigenden Dollars eine Kehrtwende macht.
Schulden und Leistungsbilanzdefizit
Erinnert sei an die ausgeprägten Dollarbaissen der Jahre 1978, 1995 und 2011, als der Dollar jeweils neue historische Tiefstwerte erreichte. Er lag damals deutlich unter der Kaufkraftparität und war im Kontrast zu heute unterbewertet. Als Begründung für den schwachen Dollar nannten Experten die hohe Verschuldung der Vereinigten Staaten, das bedrohliche Leistungsbilanzdefizit, die hohe Inflation und die Befürchtung, die führende Weltmacht könnte wirtschaftlich schon bald von China überrollt werden.
Heute will von diesen kritischen Tönen niemand mehr etwas wissen, obwohl die Verschuldung der USA noch schlimmer geworden ist, der Aussenhandel Rekorddefizite verzeichnet und eine Rezession vor der Tür steht.
Genauso wie sich prognostizieren lässt, dass Aktien in der langen Frist steigen, lässt sich vorhersagen, dass Währungen von Ländern mit hoher Inflation und hohen Zinsen langfristig sinken. Zwar können Über- und Unterbewertungen lange bestehen bleiben, bis der Trend kehrt, und das Timing zur Vorhersage der Trendwende gestaltet sich schwierig, doch Investoren mit (zu) hohem Dollar-Exposure sind gut beraten, frühzeitig zu handeln. Das gilt auch für die Schweizerische Nationalbank, die gegen 40% ihrer gigantischen Währungsreserven im überbewerteten Dollar hält. Was den Euro betrifft, der unter der Schuldenlast seiner Mitgliedländer leidet, hat sie den Zeitpunkt zum Risikoabbau verpasst.
Dr. Pirmin Hotz
ist Gründer und Inhaber der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG mit Sitz in Baar
- Prognosefähigkeit
- Langfristig
- Timing