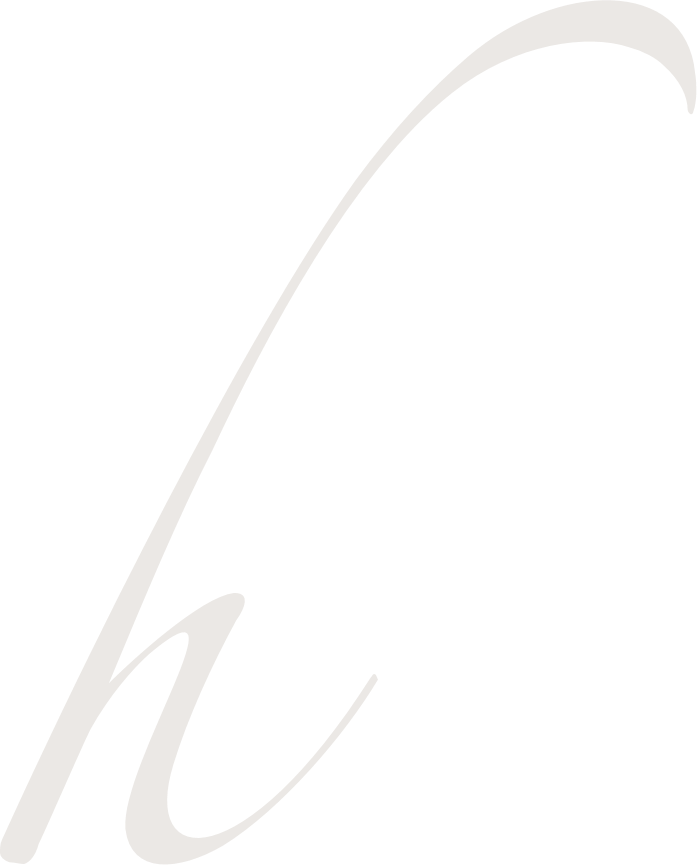Sind Immobilien oder Aktien lukrativer?
Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sind in den vergangenen 25 Jahren in die Höhe geschossen.
Viele Schweizerinnen und Schweizer sind in den vergangenen Jahrzehnten mit Wohneigentum wohlhabend geworden. Dafür haben die massiven Preissteigerungen am Schweizer Immobilienmarkt gesorgt. Aber dieser Weg zum Wohlstand ist für immer weniger Menschen eine Option.
Eine Studie der Grossbank UBS von Anfang April hat untersucht, wer sich in der Schweiz noch eine Eigentumswohnung mit 110 Quadratmetern Wohnfläche und einer anfänglichen Belehnung von 80 Prozent leisten kann. Dabei kamen die Ökonomen der Bank zu dem Ergebnis, dass selbst für einen Haushalt mit einem überdurchschnittlichen Einkommen von 200 000 Franken nur knapp die Hälfte der damals ausgeschriebenen Objekte noch finanziell tragbar waren.
Für viele Schweizerinnen und Schweizer war der Kauf von Wohneigentum eine Art Königsweg in der Altersvorsorge – mit dem Nebeneffekt, dass sie damit ein stattliches Vermögen aufgebaut haben. Wenn dies für viele nun nicht mehr möglich ist, stellt sich die Frage, ob für sie der Vermögensaufbau mit Aktien eine Alternative ist. Denn auch mit Aktien haben Anleger in den vergangenen Jahrzehnten hohe Renditen erzielt. Zudem können sie sich bereits mit kleineren Beträgen am Aktienmarkt engagieren und haben bei ihrer Vermögensanlage kein «Klumpenrisiko» wie mit einem Eigenheim. Wohneigentum und Aktien haben derweil unterschiedliche Vor- und Nachteile.
Carouge schlägt alle
Wie Daten von Immobilienexperten zeigen, waren die Wertsteigerungen bei Eigenheimen in vielen Regionen in der Schweiz in den vergangenen Jahrzehnten tatsächlich massiv. Laut Donato Scognamiglio, Verwaltungsratspräsident des Beratungsunternehmens Iazi, hat der Iazi-Private-Real-Estate-Index, ein Barometer für die Preise von Schweizer Wohnimmobilien, seit dem Jahr 2000 um rund 130 Prozent zugelegt. Der Index basiere auf effektiv bezahlten Transaktionen und nicht auf den Inseratepreisen, konkretisiert Scognamiglio.
Eine Iazi-Auswertung zeigt derweil, dass die Entwicklung der Immobilienpreise in manchen Schweizer Städten und Gemeinden noch viel extremer war. Dabei wurden Städte und Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnerinnen und Einwohnern berücksichtigt.
In Carouge, einer der begehrtesten Wohnlagen im Kanton Genf, haben sich die Preise gemäss der Erhebung seit dem Jahr 2000 mehr als vervierfacht. «Ein Haus, das im Jahr 2000 dort noch 645 000 Franken kostete, ist heute rund 2,87 Millionen Franken wert», sagt Scognamiglio. Berücksichtige man die bezahlten Hypothekarzinsen – der Immobilienexperte nennt hier einen Zins von durchschnittlich 2,5 Prozent in den letzten 25 Jahren –, dann ergebe sich ein beeindruckender Wertzuwachs des eingesetzten Eigenkapitals von 1475 Prozent. Mit dem ursprünglich eingesetzten Eigenkapital von 129 000 Franken – also 20 Prozent von 645 000 Franken – sei in dem Beispiel ein Gewinn von rund 2 Millionen Franken erzielt worden.
Schweizer Wohneigentum mit hohen Renditen

Die Hypothek als Risikofaktor
«Dies funktioniert allerdings nur so lange, wie die Immobilienpreise steigen», sagt Scognamiglio. Und wer bei Investitionen viel Fremdkapital einsetze, müsse sich bewusst sein, dass es in einem Abschwung auch mit einem Hebel nach unten gehe. «Hohe Hypothekarschulden können in einer Krise auch als Brandbeschleuniger wirken», sagt Scognamiglio.
Fredy Hasenmaile, Chefökonom von Raiffeisen Schweiz, spricht sich indessen ebenfalls für Wohneigentum als Geldanlage aus. Er beziffert die durchschnittliche Eigenkapitalrendite von Schweizer Wohneigentum in einer Studie von November vergangenen Jahres auf jährlich 7,2 Prozent seit dem Jahr 1988. Dabei sei die Schweizer Immobilienkrise der neunziger Jahre mitberücksichtigt und die Rendite liege trotzdem nur knapp hinter derjenigen von Aktien zurück, sagt er. Ein reines Schweizer Aktienportfolio habe im selben Zeitraum eine Rendite von 8,1 Prozent erreicht – allerdings ohne Einsatz von Fremdkapital.
Die Berechnung der Eigenkapitalrendite von Wohneigentum in der Studie von Raiffeisen ist komplex. Für die Analyse wurden allerhand Faktoren berücksichtigt. Dazu zählen die eingesparte Miete, die Zinskosten der Hypothek, die Unterhaltskosten, der Effekt des Wohneigentums auf die Einkommenssteuern und die Wertveränderung der Immobilie. Zudem wurde die Belastung des Eigenmietwerts für den Wohneigentümer einkalkuliert. Des Weiteren sei der Tatsache Rechnung getragen worden, dass Hauseigentümer beim Unterhaltsabzug rund 30 Prozent mehr Abzüge geltend machen können, als tatsächliche Ausgaben anfallen, sagt Hasenmaile. Ausserdem seien bei der Berechnung der Rendite die Grundstückgewinnsteuer sowie die Hebelwirkung der Hypothek berücksichtigt.
Der Ökonom nennt mehrere Vorteile von Wohneigentum gegenüber Aktien. Die Rendite von Immobilien werde mit weniger Schwankungen erzielt, sagt er. Zudem zwinge die Illiquidität von Wohneigentum die Eigentümer dazu, kontinuierlich investiert zu bleiben – auch in Krisenzeiten. «Dies sorgt für ein optimales Anlageverhalten», sagt Hasenmaile.
Allerdings sind auch die Risiken von Wohneigentum nicht zu unterschätzen. «Bei grossen Werteinbrüchen der Immobilie kann die Hebelwirkung des Fremdkapitals das ganze investierte Eigenkapital oder sogar noch mehr vernichten.» Könne der Käufer die Hypothek nicht mehr bedienen, drohe zudem die Gefahr, dass er das Wohneigentum zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt verkaufen müsse.
«Viele potenzielle Käufer zweifeln momentan, ob Wohneigentum auch in Zukunft eine hohe Eigenkapitalrendite erzielen wird», sagt Hasenmaile. Er geht indessen davon aus, dass dies weiterhin der Fall sein wird. Dafür sprächen beispielsweise die Zuwanderung sowie die Tatsache, dass Immobilien in der Schweiz ein knappes Gut seien. Aus seiner Sicht brauchte es «einen massiven Vertrauenseinbruch», damit die Preise von Schweizer Wohnimmobilien sinken würden.
Der Zuger Vermögensverwalter Pirmin Hotz bricht indessen eine Lanze für Aktien. Laut Berechnungen der Bank Pictet haben Schweizer Aktien seit 1926 eine jährliche Nominalrendite von 7,7 Prozent erzielt, nach Abzug der Inflation waren es 5,6 Prozent. «Das schlägt jede andere Anlagekategorie», sagt er.
Weniger euphorisch äussert sich der Vermögensverwalter über die Renditen von Liegenschaften, auch in der Schweiz. «Viele Immobilienbesitzer tendieren dazu, die Rendite ihrer Anlage zu überschätzen», sagt der Vermögensverwalter. Wenn jährlich 1 Prozent des Immobilienwerts für Unterhalts- und Nebenkosten budgetiert werde, sei dies langfristig zu wenig, weil darin einmalige Aufwendungen sowie Rücklagen für Erneuerungen und Sanierungen nicht ausreichend abgebildet seien.
Zudem rechneten sich viele Wohneigentümer reich. Sie bezögen die Rendite nicht auf den Marktwert – so wie bei Aktien üblich –, sondern auf den Anschaffungspreis ihrer Liegenschaft, sagt Hotz. «Das wäre etwa so, wie wenn Novartis-Aktionäre ihre Dividendenrendite nicht auf den aktuellen Marktpreis der Aktien, sondern auf den niedrigen Einstandspreis vor 10 oder 20 Jahren bezögen.»
Kritisch äussert sich der Vermögensverwalter auch zu Berechnungen der Rendite von Liegenschaften auf das eingesetzte Eigenkapital und nicht auf den Gesamtwert. «Wer die Gesamtrenditen von Aktien mit Immobilien sinnvoll vergleichen will, muss beidseits das risikotragende Kapital zugrunde legen, sonst werden Äpfel mit Birnen verglichen.» Die Aktienrenditen würden schliesslich auch nicht mit geliehenem Kapital erzielt.
Hotz schätzt die Nettorenditen von Liegenschaften auf zwischen 4 und 5 Prozent, was einer Realrendite von 2,5 bis 3 Prozent entspreche. «Damit sind Immobilien die zweitattraktivste Anlagekategorie nach Aktien.» Für noch höhere Renditen brauche es quasi «eine explosionsartige Entwicklung der Landpreise», sagt Hotz. Die Häuser und Wohnungen, die auf dem Land stehen, sind schliesslich mit der Zeit immer weniger wert.
«Historische Tiefzinsen haben die Preise von Immobilien insbesondere an bevorzugten Lagen in den letzten zwei Jahrzehnten befeuert», sagt Hotz. «Käufer von Wohnliegenschaften akzeptieren in so einem Umfeld Bruttorenditen von 2 Prozent und weniger.» Bei Lichte betrachtet resultiere daraus eine Nettorendite, die nahe an der Nulllinie liege.
Lange Schönwetterperiode
Laut Hotz werden die Risiken von Immobilien unterschätzt, weil die letzte grosse Immobilienkrise in der Schweiz mittlerweile knapp drei Jahrzehnte zurückliegt. Damals seien als Folge drastischer Zinserhöhungen die Preise für Wohn- und Büroliegenschaften um 30 bis 50 Prozent abgesackt. «Seitdem gab es eine lange Schönwetterperiode am Schweizer Immobilienmarkt», sagt Hotz.
Im Geschäft mit Liegenschaften werde in der Schweiz nicht selten ein Fremdkapitalanteil von 50 bis 80 Prozent eingesetzt. «Es braucht keine hellseherischen Fähigkeiten, um vorauszusagen, dass im Falle eines drastischen Zinsanstiegs auf beispielsweise 4 oder 5 Prozent viele Eigenheimbesitzer, Immobilienunternehmen und kreditgebende Banken in die Bredouille kommen würden», sagt Hotz.
So gibt es schliesslich mehrere Wege zum Vermögensaufbau – Immobilien und Aktien sind hier letztlich beide sehr gut geeignet. Die Wahl zwischen diesen beiden Anlagen ist nicht nur von den finanziellen Möglichkeiten, sondern auch den persönlichen Präferenzen und der Risikobereitschaft abhängig.