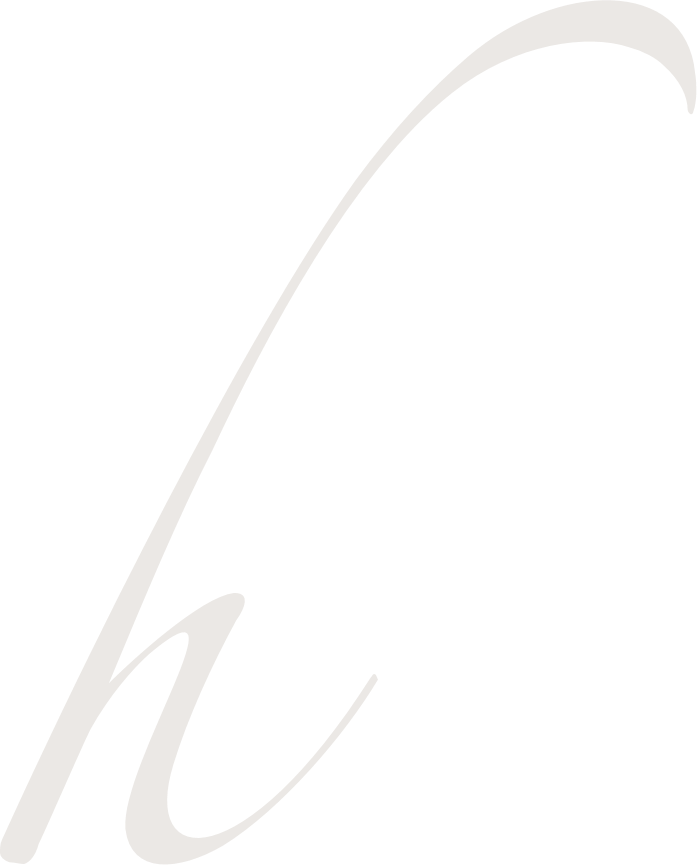Die grösste Blase aller Zeiten
Wer Aktien von Roche kauft, beteiligt sich an einem Unternehmen, das 1896 von Fritz Hoffmann-La Roche gegründet wurde, um mit Forschern neue Medikamente zu entwickeln und diese in aller Welt zum Nutzen unzähliger Patienten zu verkaufen. Für ihr Risiko werden die Eigentümer mit einer Dividende und einem langfristig steigenden Aktienkurs entschädigt. Der Wert der Aktie hat sich im Laufe der Zeit verdoppelt und verzehnfacht.
Um dies möglich zu machen, musste Roche seinen Umsatz und Gewinn in gleichem Masse steigern. Was wäre aus einem Franken geworden, der bei der Gründung von Roche in das Unternehmen investiert wurde, wenn eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8% unterstellt wird? Unter der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert wurden, resultiert ein heutiges Endvermögen von rund 20 000 Fr. Das ist das berühmte Wunder des Zinseszinses.
Anders verhält es sich beim Bitcoin, dem König der Kryptowährungen. Er wurde aus dem Nichts geschaffen. Käufer beteiligen sich weder an einer unternehmerischen Leistung, noch gibt es einen Zins oder eine Dividende. Beim Start 2008 kostete ein Bitcoin 0,8 Rappen. Bei insgesamt 21 Mio. Bitcoins entsprach dies einem Marktwert von 168’000 Franken. Kaum ein Mensch interessierte sich damals für die Kryptowährung. In der Zwischenzeit hat der Bitcoin die Grenze von 90'000 Fr. geknackt, was über elf Millionen Mal so viel wie damals ist.
Vom Saulus zum Paulus
Die jährliche Rendite von 160% ist 20-mal so hoch wie jene von Roche. Der Gesamtwert aller Bitcoins hat sich innerhalb von weniger als 17 Jahren von 0,00168 auf 1'900 Mrd. Franken erhöht. Es stellt sich die Frage, wie dieser gigantomanische Kursanstieg zu rechtfertigen ist. Partizipieren Inhaber von Bitcoins am innovativen Potenzial der Blockchain-Technologie? Fehlanzeige: Davon profitieren nicht die Bitcoiners, sondern einzig die Aktionäre der Blockchain-Firmen. Der märchenhafte Anstieg des Bitcoin-Kurses basiert allein auf Glauben und Hoffnung.
Der Kryptocommunity ist es erstaunlich gut gelungen, die einst grössten Kritiker für ihre Idee zu gewinnen. So mutierte US-Präsident Donald Trump, der in seiner ersten Amtszeit beim Bitcoin noch von Betrug sprach, zum glühenden Anhänger und notorischen Manipulator von Kryptowährungen. Im Januar hat er seinen eigenen Trump-Coin lanciert. Angetrieben von Wahlkampfspenden in dreistelliger Millionenhöhe will Trump, flankiert von seinem Sekundanten Elon Musk, die Vereinigten Staaten zur weltweiten «Bitcoin-Superpower» machen und für das Land eine strategische Bitcoin-Reserve äufnen.
Larry Fink, Chef des weltgrössten Vermögensverwalters BlackRock, bezeichnete im Jahr 2017 den Bitcoin als Mittel zur Geldwäsche. Dann kam die radikale Kehrtwende. Anfang 2024 hat BlackRock den ersten Bitcoin-ETF lanciert, nachdem das Unternehmen erheblichen Druck auf Gary Gensler, Ex-Chef der US-Börsenaufsicht SEC und gefürchteter Kryptogegner, ausgeübt hatte. Hat die Geldgier den klaren Verstand von Larry Fink vernebelt? Durch die SEC-Zulassung von ETF hat der Bitcoin die Schmuddelecke verlassen und sich aufs Terrain der traditionellen Anlageklassen hineingekämpft. Die Zulassung von ETF war der Ritterschlag für Kryptofans.
Inzwischen sind die Kantonalbanken von Luzern, Zug und Zürich, PostFinance sowie zahlreiche Pensionskassen auf den Zug der wundersamen Geldvermehrung aufgesprungen. PostFinance spricht von einer «Demokratisierung», einem «Zugang zum Kryptomarkt für alle» und einem «Meilenstein in unserer Firmengeschichte». Ein Initiativkomitee will gar in der Bundesverfassung festschreiben, dass die Schweizerische Nationalbank (SNB) Bitcoin als Reservewährung halten muss. Werden die Schweiz und andere Länder derartigen Begehren auf den Spuren von El Salvador sowie der Zentralafrikanischen Republik Folge leisten, wird der Bitcoin-Kurs nach dem Prinzip der «Selffulfilling Prophecy» in unvorstellbare Höhen vorstossen, denn das System ist mit der strikten Begrenzung auf 21 Mio. Coins clever konzipiert.
Als ein Hauptargument, Bitcoin zu halten, wird seine Funktion als Inflationsschutz angeführt. In der Tat tendiert der kaufkraftbereinigte Wert von Dollar, Pfund, Euro (inklusive seiner Vorgängerwährungen) und auch der des Frankens im Laufe von 100 oder 200 Jahren gegen null. Wer im Jahr 1850 den Betrag von 1'000 Fr. unter seine Matratze gelegt und das Geld über 175 Jahre nie in Aktien, Obligationen oder Immobilien investierte, besitzt heute noch rund 5% seiner damaligen Kaufkraft.
Exakt aus diesem Grund werden langfristig disponible Gelder in Realwerte wie Aktien von Roche investiert, um sie inflationsbereinigt zu mehren. Dafür braucht es keine Kryptowährungen, sondern in erster Linie fleissige Menschen, die in Unternehmen arbeiten, jeden Tag Produkte und Dienstleistungen auf den Markt bringen und Wertschöpfung generieren. Die ursprüngliche Idee von libertären Bitcoin-Enthusiasten war es, der staatlichen Aufsicht, einem potenziellen Staatsbankrott und dem traditionellen Währungssystem zu entfliehen.
Das Ziel wurde komplett verfehlt, denn kaum jemand bezahlt heute seine Ferien, seinen Coiffeur, sein Auto oder seinen Metzger mit Bitcoin. Statt als Zahlungsmittel hat sich Bitcoin als reines Spekulationsinstrument durchgesetzt, das bei Lichte betrachtet keinen Wert besitzt, kaum Nutzen stiftet und die Illusion schürt, ohne Arbeit schnell reich zu werden.
Sektenähnliche Organisation
Bitcoin ist die grösste Blase in der Finanzgeschichte. Sie erinnert an die Tulpenmanie im 17. Jahrhundert und an Ponzi- respektive Schneeballsysteme. Sie funktionieren so lange, wie sich neue Fans finden lassen, die das System mittragen und weiterverbreiten. Die sektenähnliche Kryptocommunity ist mit Heerscharen von Influencerinnen und Influencern sowie einer zunehmenden Zahl von Kryptokonferenzen hervorragend vernetzt. Sie sorgt dafür, dass die Zahl der Gläubigen weiter zunimmt.
Als nächstes Kursziel wird in diesem Jahr die Marke von 180 000 bis 200 000 $ angepeilt, wie Luzius Meisser, Verwaltungsrat von Bitcoin (Suisse), am 16. Januar in der SRF-Sendung «Bilanz - Standpunkte» verkündete. Dabei bezieht er sich auf Analysen seiner Research-Abteilung. Allerdings fragt sich, auf welche Berechnungen abgestützt wird, denn die Ermittlung eines fairen Werts ist schlicht ein Ding der Unmöglichkeit, wenn es nichts zu bewerten gibt.
Das langfristig grösste Risiko droht den Kryptofans durch Regulierung, denn unter ihnen tummeln sich viele Cyberkriminelle, Drogendealer und Geldwäscher. Doch mit der Einsetzung von Paul Atkins als neuer Chef der SEC sieht es zurzeit eher nach Deregulierung aus. Er gilt als Freund der Kryptoindustrie.
So kann die Community frivol weiterzocken. Gekauft wird oft einzig deshalb, weil die Kurse steigen, der Nachbar einen Haufen Geld verdient, man beim Abseitsstehen etwas verpassen könnte und weil man hofft, einen noch Verrückteren zu finden, der einem mehr bezahlt, als man selbst bezahlt hat - das berühmte «Greater Fool»-Phänomen.
In wenigen Jahren soll der Bitcoin die Millionengrenze knacken. Wenn es der Community weiterhin gelingt, Gläubige in Scharen anzuwerben, und die Zahl der Kryptoatheisten weiter schwindet, ist die Erreichung dieses Ziels realistisch, sodass die grösste Blase der Finanzgeschichte noch lange nicht platzen wird. Das ändert jedoch nichts daran, dass der intrinsische Wert aller Bitcoins dieser Welt bei null liegt.
Dr. Pirmin Hotz
Pirmin Hotz ist Gründer und Inhaber der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG mit Sitz in Baar.
- Alternative Anlagen
- Diversifikation
- Nachhaltigkeit