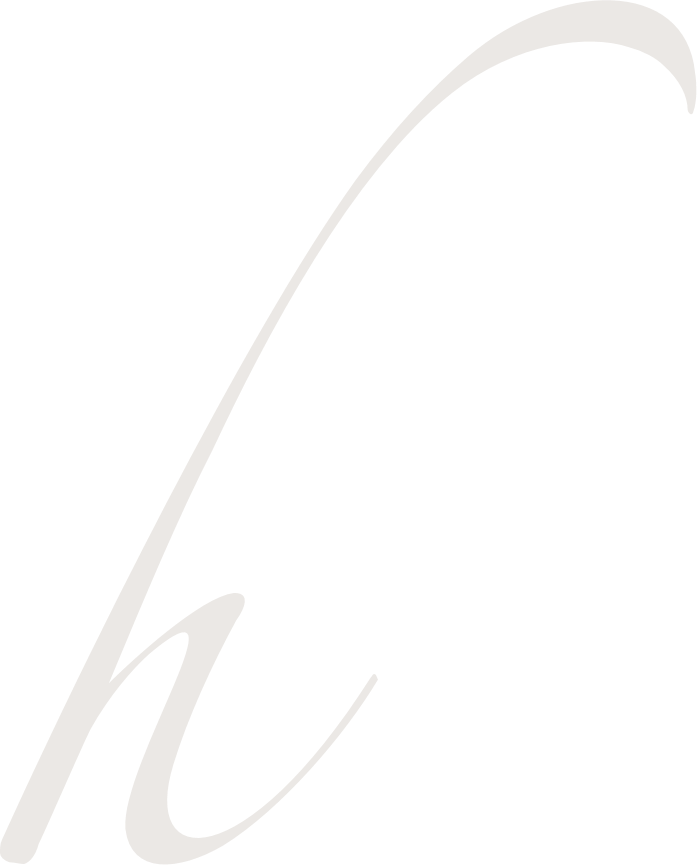Die Bombe in den Portfolios
Während erfahrene Investoren mit strukturierten Produkten ein klares Ziel verfolgen, sind Privatanleger häufig überfordert, die Risiken klar abschätzen zu können.
Welcher Anleger kann von sich behaupten, die Funktionsweise von «Range Target Profit Forwards» oder «Conditional Target Redemption Forwards» zu kennen und erklären zu können? Es dürften die wenigsten sein, denn erfahrungsgemäss versteht diese Produkte selbst unter professionellen Geldverwaltern nur eine Minderheit - viele davon dank mathematischem Spezialwissen.
Vermögenden Kunden der UBS sind notabene solche strukturierten Devisenderivate zum Verhängnis geworden, wie unlängst bekannt wurde. Mit dem Kauf vorstehender Produkte setzten sie darauf, dass sich der US-Dollar innerhalb einer bestimmten Bandbreite bewegt. Ist dies der Fall, winken attraktive Erträge, die jedoch in der Höhe limitiert sind.
Durchbricht hingegen der Dollar einen vorgegebenen Referenzkurs, drohen Verluste, die das Mehrfache der maximal erzielbaren Gewinne ausmachen können. Die Risiken der Käufer sind asymmetrisch verteilt, und es erfordert Fachwissen, um zu verstehen, wie hoch die potenziellen Gewinne und Verluste bei all den möglichen Kursverläufen sein können, die der Dollar während der Laufzeit des Produkts nehmen kann.
Erschwerend kommt dazu, dass bei gewissen Produkten die Risiken gehebelt (Leverage) sind und eine Nachschusspflicht (Margin Call) ausgelöst werden kann. Nachdem US-Präsident Donald Trump am 2. April ein neues Zollregime verkündet hatte, verlor der Dollar rapide an Wert und durchbrach den unteren Referenzkurs der Strukis, sodass die Besitzer teilweise verheerende Verluste erlitten.
Wo die Produkte Sinn machen
Kunden der UBS machten in der Folge geltend, von ihren Bankern nicht ausreichend über Risiken, Hebelwirkung und Nachschusspflicht informiert worden zu sein. Offenbar hat die Bank solche Produkte auch an wenig erfahrene Kunden verkauft, weshalb sie zumindest teilweise für die entstandenen Verluste aufkommt.
Gut verstanden und richtig angewendet haben Strukis ihre Existenzberechtigung. So kann ein Schweizer Industrieunternehmen mit einem massgeschneiderten Konstrukt gezielt die Verpflichtung eingehen, zu potenziell tieferen Kursen Dollars zu kaufen, um seine zukünftigen Importe aus den USA zu begleichen, und gleichzeitig einen Zusatzertrag generieren. Erfahrenen Investoren dienen Strukis in spezifischen Marktsituationen als Portfolioergänzung. Besonders beliebt sind die sogenannten Barrier Reverse Convertibles (BRC), welche mit einer attraktiven Verzinsung locken. Die Käufer dieser Produkte rechnen mit seitwärts, leicht höher oder tiefer tendierenden Kursen ausgewählter Aktien. Fallen die Kurse stärker, bieten BRC über die eingebaute Short-Put-Option die Möglichkeit, Aktien zu tieferen Kursen ins Portfolio aufzunehmen.
Ein Problem von BRC-Produkten, denen in der Regel mehrere Aktien zugrunde liegen, besteht darin, dass sie nach dem Worst-of-Prinzip funktionieren. Bei Unterschreiten der Barriere wird bei Fälligkeit derjenige Titel mit der schlechtesten Kursentwicklung geliefert. Die Folgen werden von Investoren oft unterschätzt.
In vielen Strukis befinden sich nämlich dieselben oder ähnliche Basiswerte, sodass während einer Baisse und bei Unterschreiten der «Knock-out-Barriere» Klumpenrisiken in den Portfolios entstehen. Verheerend wirkte sich dies am Beispiel des deutschen Zahlungsdienstleisters Wirecard aus.
Das einstige «Wunderkind» der Deutschen Börse war aufgrund der fulminanten und volatilen Kursentwicklung ein begehrtes Objekt der Struki-Branche. In der Schweiz waren 167 Barrier-Produkte kotiert, die Wirecard als Basiswert verwendeten. Als das Unternehmen im Jahr 2020 spektakulär kollabierte und Insolvenz anmeldete, mussten sich zahlreiche Anleger die Augen reiben, denn bei allen Strukis wurde die Barriere gerissen. Zur Rückzahlung erhielten sie faktisch wertlose Titel von Wirecard.
In starken Baissen können strukturierte Produkte potenziell zu Brandbeschleunigern in Wertschriftenvermögen werden, wenn mehrere branchenähnliche oder sogar gleiche Titel in ein Portfolio gespült werden - das ist die Antithese der hochgelobten Diversifikation in der Vermögensanlage.
BRC werden von Banken gerne als «Renditeoptimierungsprodukte» verkauft. Das Beispiel Wirecard zeigt, wie irreführend dieser Begriff ist. Während nämlich der Gewinn auf eine überdurchschnittlich hohe Zinszahlung beschränkt ist, kann im Fall eines Unternehmensbankrotts einer einzigen Aktie ein Totalverlust des Struki entstehen.
Viele Banken führen Strukis unter der Rubrik «Obligationen» auf. Das ist irritierend, denn die Verlustrisiken sind in Baissephasen vergleichbar mit denjenigen von Aktien. Fehlt das erforderliche Expertenwissen im Umgang mit Strukis, kann ein vermeintlich konservatives Portfolio in einer markanten Börsenkorrektur fast über Nacht zu einem riskanten Junk-Aktienportfolio mutieren.
Das geschah in der Finanzkrise, als Banken wie die UBS wie Dominosteine fielen und deren Aktien mit Verlusten von teilweise über 80% gehäuft in den Depots der Struki-Besitzer landeten. In einigen Fällen resultierten in Portfolios, die mit Strukis bestückt waren, höhere Risiken respektive Verluste, als wenn in ein reines, aber gut diversifiziertes Aktienportfolio investiert worden wäre.
Die Praxis zeigt, dass Wertschriftendepots, die Strukis enthalten, bezüglich eingegangener Risiken schwer zu beurteilen sind. Je nach Art der Produkte und je nach Marktsituation können sie näher bei Obligationen oder bei Aktien liegen. Nicht zu unterschätzen ist auch das Gegenparteirisiko, das Struki-Besitzer oft eingehen.
Geht die emittierende Bank bankrott, so fällt das Produkt in ein schwarzes Loch - so geschehen bei der amerikanischen Bank Lehman während der Finanzkrise. Die Investorenlegende Warren Buffett beschreibt diesen Albtraum so: «Erst wenn die Ebbe kommt, erkennt man, wer nackt geschwommen ist.»
Verkaufsdruck und Interessenkonflikt
Wer Aktien kauft, hat einen Anlagehorizont von mindestens acht bis zehn Jahren. Käufer von Strukis schliessen hingegen Wetten auf ein Jahr ab und trauen sich auf diese kurze Zeit eine Marktprognose für eine, zwei oder drei Aktien zu.
Ob dies aus portfoliostrategischer Sicht Sinn ergibt, ist zumindest fragwürdig. Ein wesentlicher Malus sind auch die hohen Kosten von Strukis, die in der Regel um die 2% betragen. Das mag attraktiv für die Produktartisten sein, doch gehen sie am Ende zulasten der Anleger.
Einige Banken verhökern hochmargige Strukis mit Hochdruck an ihre Kunden und erstellen regelmässig interne Listen der erfolgreichsten Verkäufer dieser Produkte. Das ist stossend und führt zu Interessenkonflikten der Angestellten.
Gleichzeitig sichern sich Banken ab, indem sie dem Verkaufsprospekt umfangreiche «Beipackzettel mit Risiken und Nebenwirkungen» beilegen. Aber wer hat schon die Lust und Zeit, diese zu lesen? Dabei müssten es ja gerade die «Verpackungskünstler» der Banken selbst wissen, wie gross die Risiken sind, sich mit Strukis zu vergaloppieren.
So wurden ihnen in der Finanzkrise strukturierte Produkte wie ABS (Asset-backed Security), CDO (Collateralized Debt Obligation) oder MBS (Mortage-backed Security) vollends zum Verhängnis. Sie liessen sich damals von ihren eigenen, hoch komplexen Risikomodellen überlisten und verloren dabei buchstäblich den Überblick. Der Durchschnittsanleger ist mit der Komplexität von Strukis definitiv überfordert. Er sollte die Finger davon lassen.
Dr. Pirmin Hotz
Pirmin Hotz ist Gründer und Inhaber der Dr. Pirmin Hotz Vermögensverwaltungen AG mit Sitz in Baar.
- Alternative Anlagen
- Diversifikation
- Direktanlagen und Transparenz
- Interessenkonflikte
- Verkaufsdruck
- Renditeberechnung