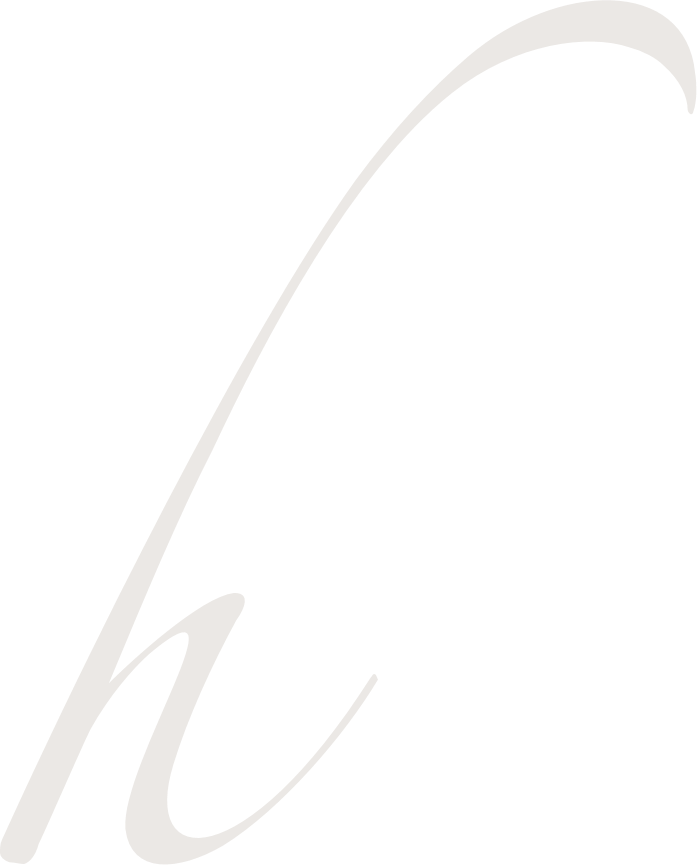Jahresendbericht 2023
Bis zum Herbst erwiesen sich die Aktienmärkte als sehr robust und es bestand die Hoffnung, dass auf das negative 2022 ein Jahr mit überdurchschnittlich hoher Rendite folgen würde. Doch nach dem überraschenden Angriff der Hamas auf Israel wendete sich zwischenzeitlich das Blatt. Neben dem Konflikt im Nahen Osten belasten der Krieg in der Ukraine, eine hartnäckig hohe Inflation in den führenden Industrieländern und steigende Zinsen die Börsen. Diese setzten im Spätherbst zu einer Erholung an. In diesem anspruchsvollen Umfeld ist es besonders wichtig, eine langfristig sturmerprobte und qualitativ hochwertige Anlagestrategie zu verfolgen.
«Ich bin der festen Überzeugung, dass der Versuch, in jedem einzelnen Jahr eine überragende Performance anzupeilen, nicht von Erfolg gekrönt sein wird. Vielmehr führt das Bestreben, durch Disziplin in schlechten Zeiten relativ betrachtet deutlich überlegene Ergebnisse zu erzielen, zu weniger Volatilität und zu weniger grossen Verlusten, die schwer wettgemacht werden können. Jedes Jahr ein wenig besser als der Durchschnitt abzuschneiden, führt am Ende zu mehr Erfolg.»
Diese aus unserer Sicht zutreffende und pointierte Aussage stammt von Howard Marks. Marks ist Gründer der amerikanischen Investmentfirma Oaktree und bekannt für seine legendären Anlagebriefe. Das Orakel von Omaha, Warren Buffett, liest diese stets mit Interesse. In Übereinstimmung mit dem Eingangszitat von Howard Marks, welches wir der Online-Zeitung «The Market» entnommen haben, hängt der langfristige Erfolg eines Anlagespezialisten nicht davon ab, ob er in einzelnen Jahren der Beste aller Vermögensberater ist – auch wenn dies, wie unsererseits im Jahr 2022, zufälligerweise der Fall sein kann. Wer gezielt versucht, in einzelnen Jahren die Nummer 1 von beispielsweise 100 Experten zu sein, wird unweigerlich scheitern, weil er zu hohe Risiken eingeht. Langfristig Erster wird sein, wer die grossen Fehler und Verluste vermeidet.
In der Geldanlage beschäftigen sich viele Investoren mit der Frage, wann wohl das richtige Timing für den Kauf und Verkauf von Aktien oder welches aktuell der aussichtsreichste Titel sei. Solche Fragen mögen besonders in Zeiten hoher Verunsicherung und Volatilität an den Märkten spannend klingen, aber sie sind im Grunde ziemlich irrelevant oder zumindest zweitrangig. Entscheidend am Ende ist nämlich, die richtige Anlagestrategie zu definieren und auf die langfristig aussichtsreichsten Anlagekategorien zu setzen. Die Erzielung einer dauerhaft attraktiven Rendite ist schliesslich nicht das Resultat orakelmässiger Vorhersagen, sondern die Folge einer erfolgreichen Anlagestrategie. In diesem Zusammenhang ist interessant, einmal einen Blick auf die Anlagestrategien von Family Offices, die grosse Vermögen reicher Familien disponieren und überwachen, zu werfen. Die UBS gibt in ihrem «Global Family Office Report 2023» Aufschluss, in welche Anlagekategorien vermögende Familien in aller Welt ihre Gelder lenken. Auf dem Radar der Grossbank befinden sich 230 Family Offices mit einem Gesamtvermögen von insgesamt rund USD 500 Mrd. Im Durchschnitt investieren die global vertretenen Family Offices 25 Prozent in Aktien der Industrieländer, 6 Prozent in Aktien der Schwellenmärkte, 11 Prozent in Anleihen von Industrienationen und 3 Prozent in Schwellenmarktanleihen. In Private Equity legen reiche Familien 19 Prozent ihrer Vermögen an, 13 Prozent fliessen in Immobilien und 7 Prozent in Hedge Funds. Die restlichen Mittel verteilen sich auf Cash (9 Prozent), Private Debt (2 Prozent), Gold (2 Prozent), Kunst (2 Prozent) und Rohstoffe (1 Prozent).
«Der Unterschied zwischen erfolgreichen Leuten und sehr erfolgreichen Leuten ist, dass die sehr erfolgreichen Leute zu beinahe allem «Nein» sagen.»
Welche Schlüsse lassen sich aus der Anlagepolitik reicher Familien ziehen? Wenig überraschend investieren sie mit 63 Prozent fast zwei Drittel ihrer Gesamtvermögen in produktive Realwerte, zu denen Aktien, Private Equity und Immobilien gehören. Es gibt keinen Zweifel, dass die langfristige Vermögensbildung und -vermehrung am allerbesten mit Unternehmensbeteiligungen und Immobilien gelingt. Weiter ist die Tatsache bemerkenswert, dass Aktien – sei dies in Form kotierter Aktien oder Private Equity – exakt die Hälfte der Vermögensmasse reicher Familien ausmachen, während Immobilien mit 13 Prozent weit dahinter rangieren. Dies deckt sich mit unserer Überzeugung, dass Immobilien eine zwar durchaus attraktive Anlagekategorie darstellen, bezüglich Renditen aber oft über- und bezüglich Risiken unterschätzt werden. Im Kontrast zu diesem Befund liegt allerdings der Anteil an Immobilien am Gesamtvermögen des Durchschnittsinvestors in der Schweiz und in Deutschland sehr viel höher als der Anteil Aktien – in weiten Teilen der Bevölkerung repräsentiert Betongold sogar den klar dominierenden Anteil am Gesamtvermögen.
Dass der Anteil an Private Equity mit 19 Prozent derart hoch ist, mag auf den ersten Blick überraschen, weil die entsprechenden Anteile institutioneller und privater Investoren viel tiefer liegen. Dazu kommt, dass nicht zuletzt von unserer Seite immer wieder Vorbehalte gegenüber diesem Segment geäussert werden. Auf den zweiten Blick ist dieser hohe Anteil aber durchaus logisch nachvollziehbar, weil ein Grossteil davon Direktbeteiligungen von vermögenden Familien an eigenen Unternehmen ausmacht (Anmerkung: So gesehen ist auch der Vermögensanteil des Schreibenden an Private Equity sehr hoch – dies in Form der Anteile des familieneigenen Vermögensverwaltungsunternehmens). Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir bezüglich der Anlageklasse Private Equity kritisch eingestellt bleiben, wie der anliegende Leitartikel «Private Equity – der Lack ist ab», den wir am 7. Oktober in der «Finanz und Wirtschaft» publiziert haben, unterstreicht.
Was an der Vermögensdisposition reicher Familien hingegen Fragen aufwirft, ist der hohe Grad an Komplexität. So liegt der Anteil hochmargiger und oft intransparenter Fund-of-Fund-Konstruktionen im zweistelligen Prozentbereich. Das erstaunt, denn es gibt aus unserer Sicht keinen Zweifel, dass diese Produkte vor allem viel kosten und ertragsmässig wenig bringen. Dass sich vermögende Privatinvestoren trotzdem zu solchen Produkten hinreissen lassen, liegt wohl nicht zuletzt an der gut geölten Marketing-Maschinerie der Banken- respektive Finanzindustrie. Mit komplexen Produkten lässt sich naturgemäss am meisten Geld verdienen, weshalb sie von der Branche mit Hochdruck vermarktet werden. Oft haben auch die Consultants von Family Offices ein Interesse an komplexen Strukturen und Produkten, denn diese rechtfertigen intensivere Beratungsdienstleistungen sowie Überwachungsfunktionen und folglich auch höhere Honorare.
«Fussball spielen ist sehr simpel, aber simplen Fussball zu spielen, ist das Schwierigste überhaupt.»
In der «UBS House View, Investor’s Guide» vom Juni letzten Jahres empfiehlt die einzig verbliebene Schweizer Grossbank dies: «Zuletzt sind wir der Ansicht, dass Multi Strategy Funds, die verschiedene Hedge-Fund-Strategien kombinieren, auch eine wichtige Komponente in Portfolios bleiben.» Ufff! Wir können die wahren Gesamtkosten dieser Wahnsinnsprodukte nur rudimentär und ohne Gewähr auf Richtigkeit abschätzen, aber wir gehen erfahrungsgemäss davon aus, dass diese über 5 Prozent betragen dürften – jährlich. Damit ist nach unserer Überzeugung äusserst unsicher, ob die betreffenden Investorinnen und Investoren für ihre Risiken überhaupt noch eine adäquate Rendite erwarten können. Vielleicht sieht das auch die UBS nicht anders, denn weiter unten wird ergänzt: «Anleger sollten beachten, dass alternative Anlagen besonderen Risiken unterliegen. Dazu zählen eine geringere Liquidität, hohe Kosten und eine erhebliche Komplexität.» Ob da wohl die Juristen der Bank ihren Kollegen aus der Marketing-Abteilung die Leitplanken gesetzt und das Sicherheitsnetz für ihre bonusgetriebenen Empfehlungen gespannt haben?
Vermögende Familien machen sehr viel richtig in ihrer Vermögensallokation, sonst wären sie nicht reich. Mit komplexen und aufwendigen Strukturen haben wir jedoch unsere Mühe. Unabhängig von der Vermögenshöhe setzen wir deshalb alles daran, für unsere Kundinnen und Kunden einfache, transparente und kostengünstige Lösungen anzustreben. Dass dies nicht allen Consultants gefällt, ist naheliegend, denn die konsequente Vernichtung von Komplexität engt das Jobprofil vieler Berater ein oder macht es sogar überflüssig. Wir können es nicht genug betonen: Verzichten Sie vollständig auf komplexe, intransparente und margenträchtige Produkte – sie machen die Anbieter reich und die Käufer arm. Gerne empfehlen wir Ihnen in diesem Zusammenhang den anliegenden Leitartikel «Fragwürdige Akzente in der Vermögensanlage», den wir am 5. August in der «Finanz und Wirtschaft» publiziert haben.
«Ich schlage vor, wir vereinfachen die Anlagewelt und es gibt nur Aktien und Obligationen.»
Per Mitte Dezember hat der amerikanische Aktienmarkt S&P 500 um 23 Prozent zugelegt. Interessant ist, dass für rund 80 Prozent dieser beeindruckenden Gewinne einzig die «Magnificent Seven» verantwortlich sind. So entpuppten sich die Tech-Schwergewichte Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Nvidia und Tesla als eigentliche Kursraketen, während es der breite Markt, der die «restlichen» 493 Titel umfasst, gemächlicher nahm – ähnlich war das bereits während der Corona-Krise. Der neue Überflieger der Tech-Giganten ist das amerikanische Unternehmen Nvidia, ein weltweit führender Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielkonsolen. Für die Anwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) nehmen die Produkte von Nvidia eine Vorreiterrolle ein. Das Gewicht, das die «Magnificent Seven» in den amerikanischen Aktienindizes, die als Basis für das passive Investieren dienen, einnehmen, ist gewaltig. So repräsentieren sie per Mitte Dezember 2023 hohe 28 Prozent des breiten S&P 500 und sogar 47 Prozent der Technologiebörse Nasdaq.
Die «Magnificent Seven» nehmen ein Gewicht von rund 19 Prozent im gesamten Weltmarktindex von MSCI ein. Das ist mehr als China, Deutschland, Frankreich, Japan und die Schweiz zusammen. Alleine Apple repräsentiert darin ein Gewicht von 5,2 Prozent – gleich viel wie alle börsenkotierten Unternehmen in Deutschland und der Schweiz zusammen. Bei aller Sympathie, auch Wachstumstitel in einem hochwertigen Aktienportfolio zu führen: Dieses Klumpenrisiko weniger Titel widerspricht unserem Grundsatz einer soliden Diversifikation, weshalb wir von der Politik der tendenziellen Gleichgewichtung unserer qualitätsorientierten Titel überzeugt sind.
«Man muss die Dinge so einfach wie möglich machen. Aber nicht einfacher.»
In jüngerer Zeit ist geradezu ein Hype rund um KI entstanden, der mit der Lancierung von ChatGPT im Jahr 2022 durch OpenAI, an der Microsoft eine signifikante Beteiligung hält, seinen Anfang nahm. Inzwischen sind auch Konkurrenten wie Amazon und Google mit eigenen Anwendungen auf den Zug aufgesprungen. Es besteht kein Zweifel, dass diese Entwicklungen weiterhin enorme Fortschritte machen und die Welt in vielen Anwendungsbereichen revolutionieren werden. Eine Frage, die sich uns als Vermögensverwalter stellt, ist diese: Wird KI respektive ein Chatbot wie ChatGPT auch die Prognose von Börsenkursen revolutionieren und uns Vermögensverwalter eines Tages vielleicht sogar überflüssig machen? Von einigen Finanzexperten und solchen, die es zu sein glauben, wird ChatGPT geradezu als Wunderwaffe unserer Zeit gepriesen, die das neue «Orakel der Börse» sein soll. Der Beitrag «Der Wau-Effekt» von Philipp Frohn in der «WirtschaftsWoche» vom 7. Juli des vergangenen Jahres gibt uns auf amüsante Weise Aufschluss, wie erfolgreich die Börsenprognosen von KI aus heutiger Perspektive sind.
Der Journalist hat untersucht, wie gut sein Hund Freddy, ein Maltesermischling, in seiner Aktienauswahl im Vergleich zu ChatGPT abschneidet. Frohn wollte wissen, ob sein Vierbeiner bei der Renditejagd ein glücklicheres Pfötchen hat als der grösste Hoffnungsträger des 21. Jahrhunderts: Künstliche Intelligenz. ChatGPT und Freddy bekamen jeweils etwas über EUR 19'000 und stellten daraus ein Portfolio zusammen. Aus 15 Branchen hatten sie jeweils drei zu wählen, und aus jeder dieser drei Branchen waren fünf von 50 Aktien zu bestimmen, so dass beide Portfolios schliesslich aus 15 Titeln bestanden. Auf jedem Zettelchen, das für Freddy am Boden bereit lag und auf dem die entsprechende Branche oder der Name der zu wählenden Aktie stand, befand sich ein identisches Futterstückchen. Die Selektion hing somit davon ab, welches Futterstückchen sich Freddy jeweils zufällig schnappte. Mit seiner Aktienauswahl konkurrierte Freddy mit den Entscheidungen des Chatbots, der mittels KI ebenfalls 15 Aktien selektionierte. Abgerechnet wurde nach sechs Wochen. Nun, wer hat den Wettbewerb gewonnen? Erstaunlicherweise ging nicht etwa der «allwissende» Chatbot als Sieger hervor, sondern Freddy. Wenige Tage, bevor Nvidia zur Kursexplosion ansetzte, holte er sich nämlich den Chip-Hersteller in sein Portfolio. Während Freddy mit einer Performance von 13,5 Prozent brillierte, legte das Portfolio von ChatGPT nur gerade um 3,5 Prozent zu und musste sich dem Maltesermischling deutlich geschlagen geben. Auch der Weltindex MSCI World avancierte in derselben Zeit «nur» um vergleichsweise bescheidene 4,1 Prozent.
Auch wenn diesem Experiment selbstverständlich jede Wissenschaftlichkeit abzusprechen ist, so ist das Resultat alles andere als überraschend. In einer Finanzwelt, in der sich neue Informationen in Sekundenschnelle in die Kurse einarbeiten, kommt selbst die KI immer einen Schritt zu spät. KI mag zwar viel oder im Extremfall sogar alles wissen, was aus der Vergangenheit bekannt ist – all diese Informationen werden jedoch in einem effizienten Markt sofort und laufend in den Kursen abgebildet. Wir sind deshalb überzeugt: KI wird unser Leben in vielen Bereichen verändern, so zum Beispiel in der Informationsbeschaffung oder im Verfassen von Texten. Dass sie eines Tages aber in der Lage sein wird, Börsenkurse systematisch – und eben nicht zufällig, wie im Falle von Freddy – vorauszusagen, glauben wir nicht. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil es diese Chatbots im Börsenhandel in Form des Hochfrequenzhandels (HFT) im Grunde schon längst gibt. Ein Grossteil des weltweiten Börsenhandels wird nämlich schon seit vielen Jahren mit intelligenten und unglaublich leistungsfähigen Hochleistungsrechnern generiert, die Transaktionen mithilfe unvorstellbarer Datenmengen in Milli- und Nanosekunden abwickeln. KI ist im Börsenhandel schon längst etabliert. Diese Tatsache wirkt sich am Ende zum Vorteil für Durchschnittsanlegerinnen und -anleger aus, denn die Kapitalmärkte sind dadurch in ihrer Preisgestaltung noch effizienter und damit fairer geworden.
«Ich persönlich stehe dem Hype um die künstliche Intelligenz skeptisch gegenüber. Ich denke, dass altmodische Intelligenz ziemlich gut funktioniert.»
Wie irrational Menschen mit dem Hype um KI umgehen, zeigte sich bei der berühmten spanischen Weihnachtslotterie. Wie die «Zuger Zeitung» Anfang Dezember vermeldete, hatte eine spanische Zeitung angekündigt, dass laut ChatGPT der dicke Hauptgewinn (El Gordo) auf die Losnummern 02 695 oder 03 695 fallen könnte. Darauf stürmten unzählige Glücksritter die Lottogeschäfte. «Es war der Wahnsinn. Alle wollten diese Losnummern haben», berichtete Maria Irles, die in der Mittelmeerstadt Elche eine Lottoverkaufsstelle führt. Die Medienmeldung war allerdings eine Ente, denn KI kann weder die Zukunft noch Gewinnzahlen einer Lotterie prognostizieren.
Banken und andere Finanzinstitute nutzen Hypes wie KI gerne, um ihre Kundinnen und Kunden dazu zu bewegen, in entsprechende Themenfonds zu investieren. Die Zahl der Themenfonds, die auf Trends und Megatrends setzen, ist in den vergangenen Jahren geradezu explodiert. In der Schweiz gibt es zurzeit rund 500 zugelassene Fonds, die gemäss dem Wirtschaftsmagazin «Bilanz» etwa 160 (!) unterschiedliche Themen abdecken. Dazu zählen neben KI zum Beispiel Themen wie Wasser, Seltene Erden, Nanotechnologie, Saubere Energie, Blockchain, Batterietechnik, Robotics, 3D-Druck, Raumfahrt, Holzwirtschaft, Cannabis, Cloud Computing, Drohnen oder die Überalterung der Gesellschaft. Themenfonds bilden die Grundlage für gute, schlüssige Geschichten, die sich hervorragend vermarkten lassen. Immer mehr Vermögensverwalter setzen deshalb solche Themenfonds ein. Die wenigsten mit Erfolg, wie eine neuere Studie des amerikanischen Finanzdienstleistungsunternehmens Morningstar aufzeigt. Demzufolge betrug die Erfolgsquote von Themenfonds im Zeitraum 2007 bis 2021 global betrachtet tiefe 10 Prozent. «In den vergangenen 15 Jahren wurden weltweit mehr als drei Viertel der thematischen Fonds geschlossen, und nur einer von zehn überlebte und erzielte eine überdurchschnittliche Performance», wird Kenneth Lamont, Themenspezialist bei Morningstar, in der «Bilanz» vom August vergangenen Jahres zitiert. Das heisst, dass von den im Jahr 2007 bestehenden Megatrend-Themenfonds per Ende 2021 nur jeder zehnte noch aktiv war und als Erfolg vermeldet werden konnte – ein ernüchterndes Ergebnis. Die Fondsspezialistin Morningstar spricht in diesem Zusammenhang von einem «Themenfriedhof». Fairerweise soll an dieser Stelle ergänzt werden, dass die Schliessungs- respektive Todesrate bei «normalen» Aktienfonds nicht weniger ernüchternd ausfällt.
Die ausgewiesenen jährlichen Gebühren von Themenfonds liegen typischerweise bei satten 1,5 bis 2,0 Prozent. Addiert man die versteckten, nicht ausgewiesenen Kosten hinzu, summieren sich die jährlichen Gebühren auf gut und gerne 2 bis 3 Prozent. Entsprechend freuen sich die Marketingabteilungen der Banken über diese horrenden Einnahmen. Als Beispiel sei der Pictet-Global Megatrend Selection erwähnt. Der Fonds der Genfer Privatbank setzt auf Megatrends wie Biotech, Digitalisierung, Ernährung, Robotics, Saubere Energie sowie Wald- und Wasserwirtschaft. Der über CHF 10 Mrd. schwere Fonds generiert alleine ausgewiesene Gesamtgebühren (TER) von jährlich über 3 Prozent respektive CHF 300 Mio. Wer Aktien der im Fonds befindlichen Ecolab, Thermo Fisher Scientific, Visa oder Waste Management halten möchte, um von den besagten Megatrends zu profitieren, kann dies mit Direktanlagen wesentlich kostengünstiger tun – zumal die Performance des Fonds unterhalb seiner selbst festgelegten Benchmark liegt. Unser Fazit ist klar: Erstens halten wir nichts von teuren Megatrend- und Themenfondsprodukten und zweitens rennen wir auch nicht einer Hype-Aktie wie Nvidia nach, die eine enorm hohe Bewertung aufweist. Die Chancen mögen hoch sein, aber mindestens ebenso hoch sind die Risiken. Mit vernünftig bewerteten Aktien von Microsoft oder Alphabet sind wir bestens abgedeckt, um von revolutionären Entwicklungen beispielsweise auf dem Gebiet der KI zu profitieren.
«Es ist nicht notwendig, aussergewöhnliche Dinge zu tun, um aussergewöhnliche Resultate zu erzielen.»
Erinnern Sie sich an den dramatischen Untergang der Credit Suisse? Natürlich ist diese Frage rhetorisch gestellt, denn er liegt weniger als ein Jahr zurück. Umso mehr erstaunt, dass gewisse Finanzexperten nichts daraus gelernt haben. Bekanntlich hat der Bund respektive ihre Aufsichtsbehörde FINMA bei der Kommunikation der Zwangsfusion mit der UBS am 19. März letzten Jahres mitgeteilt, dass die Inhaber von nachrangigen und hochriskanten CS-AT1-Anleihen (sogenannte CoCo-Bonds) ihren Einsatz vollständig verlieren würden. Mit der zwangsverordneten Abschreibung dieser Schuldverschreibungen in Höhe von CHF 16 Mrd. wurden die Eigenmittel der Credit Suisse – und folglich der übernehmenden UBS – gestärkt. Das offenkundig horrende Risiko dieser hochverzinslichen Anleihen hielt Thomas Kirchmair, Fondsmanager der Zürcher Kantonalbank, jedoch nicht davon ab, in der «Finanz und Wirtschaft» vom 10. Mai konservativen Anlegerinnen und Anlegern AT1-Anleihen der UBS und der Genfer Kantonalbank zu empfehlen. Da können wir nur den Kopf schütteln. Erfahrene Portfoliomanager müssten eigentlich wissen, dass die Risiken solcher Anleihen enorm sind. So hat Emira Marika, Leiterin Industrieländeranleihen bei Pictet Asset Management, mit ihren ebenfalls in der «Finanz und Wirtschaft» empfohlenen Tipps für konservative Anleihenkäufer innert Jahresfrist (Anfang Februar 2022 bis Ende Januar 2023) satte 21,1 Prozent Verlust eingefahren, während sich die Verluste bei Marc Bourget, Senior Portfolio Manager bei Vontobel, in derselben Zeit sogar auf sagenhafte 32,9 Prozent türmten. Sie empfahlen konservativen Investoren unter anderem Schuldner russischer Anleihen, die zwischenzeitlich wertlos geworden sind.
Wir lehnen alle Arten von hochverzinslichen, nachrangigen und riskanten Anleihen konsequent ab. Stattdessen bevorzugen wir Schuldner mit hoher Bonität und Sicherheit mit dem Ziel, das investierte Geld am Ende der Laufzeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zurückzuerhalten. Unser Credo lautet: Lieber vereinnahmen wir bei festverzinslichen Anleihen weniger Zins und halten im Gegenzug ein strategisches Übergewicht an erstklassigen Aktien, als dass wir hohe Risiken bei Anleihen eingehen. Wir beurteilen das langfristige Halten qualitativ erstklassiger Aktien im Vergleich zu spekulativen Anleihen als attraktiver und erst noch weniger riskant. Dazu lehrt uns die CS-Geschichte, dass die FINMA im Krisenfall ihre Entscheide zu CoCo-Anleihen ohne jede Vorankündigung und ohne Rücksprache mit den Aktionären der Bank durchsetzt. Diese Abhängigkeit von staatlichen Behörden ist uns suspekt.
Im Umgang mit Anleihen sind wir deckungsgleich mit dem eingangs zitierten Howard Marks, der sagt: «Bondinvestoren verbessern ihre Performance nicht durch das, was sie kaufen, sondern durch das Vermeiden von Verlierern – und darin liegt die Essenz: eine negative Kunst.» Bei Anleihen ist Disziplin besonders wichtig, denn hohe Zinserträge haben naturgemäss ihren Reiz. Viele Anlageexperten versuchen, innerhalb einer bestimmten Ratingklasse diejenigen Anleihen für ihre Kunden zu kaufen, die die höchsten Renditen abwerfen. Was auf den ersten Blick plausibel klingt, ist auf den zweiten Blick gefährlich. Nach dem Motto «der Markt hat immer Recht» gibt es nämlich in aller Regel einen Grund, warum die Verzinsung bei einem Schuldner höher ist als bei einem andern – höhere Renditen bedeuten höhere Risiken. Im Sinne von «there is no free lunch» entscheiden wir uns deshalb im Zweifelsfall gegen höhere Zinsen und für mehr Sicherheit. Dass dies in Eldorado-Zeiten, in denen die Jagd nach hohen Risiken von Erfolg gekrönt ist, zu einer temporären Unter-Performance führen kann, nehmen wir in Kauf. Die Sicherheit der Gelder unserer Kunden geht uns vor und wir sind stolz darauf, dass in unserer über 37-jährigen Unternehmensgeschichte keine einzige Anleihe nicht zurückbezahlt werden konnte respektive im Konkurs landete.
«Märkte liegen nie falsch. Meinungen dagegen oft.»
Apropos Untergang der Credit Suisse und deren Notübernahme durch die UBS: Im August verkündete die UBS, dass sie ab sofort auf sämtliche Garantien des Bundes im Zusammenhang mit der Rettung der CS verzichte – aus Sicht der Steuerzahler eine frohe Botschaft. Insgesamt hat der Bund von der UBS bis zu diesem Zeitpunkt CHF 200 Mio. als Abgeltung für ein staatlich garantiertes Notdarlehen und eine Verlustgarantie erhalten. Viele Marktbeobachter kommen deshalb zum Schluss, dass Bund und Steuerzahler erneut – wie schon bei der Rettung der UBS während der Finanzkrise im Jahr 2008 – von einer Bankenrettung profitiert hätten. Pascal Böni, Finanzprofessor der Universität Tilburg/Utrecht, kommt in seiner empirischen Studie «Helvetias Geschenk» jedoch zu einem anderen Schluss. Das von der Mega-UBS ausgehende systemische Risiko sei für die Schweiz höher, als dies bei jeder anderen globalen Bank der Fall sei. Dies hätte massive Kosten für die Schweizer Steuerzahler zur Folge.
«Das Risiko für die Eidgenossenschaft liegt primär in den ökonomischen Too-big-to-fail-Kosten. Diese sind mit dem Zusammengang von UBS und CS stark angestiegen.»
Böni untermauert seine These anhand der gestiegenen Risikoprämie für Schweizer Staatsanleihen nach der Notübernahme der CS durch die UBS. So sind die Kosten, um sich gegen einen Konkurs der Eidgenossenschaft abzusichern, vorübergehend um satte 60 Prozent angestiegen – von 0,11 auf 0,18 Prozent. Konkret heisst dies: Um Schweizer Staatsanleihen im Gegenwert von CHF 1 Mio. gegen einen Zahlungsausfall abzusichern, mussten nicht mehr CHF 1'100, sondern CHF 1'800 aufgewendet werden. Als direkte Folge davon müsse die Eidgenossenschaft mit höheren Zinsen auf ihre Schulden rechnen. Wie Pascal Böni in der «NZZ» ausführt, sei die Schweiz vor der CS-Rettung in Europa führend gewesen bezüglich ihrem tiefen Kreditrisiko. Dieses sei nun gefährdet. Aus der durch den Zusammenschluss von UBS und CS akzentuierten Too-big-to-fail-Problematik schliesst Böni, dass auf den Bund und damit die Steuerzahler erhöhte Zinskosten in Milliardenhöhe zukommen könnten. Gemäss Aymo Brunetti, Professor für Ökonomie an der Universität Bern und Vater der Too-big-to-fail-Regeln, könnte eine potenzielle Rettung der «Monster-UBS» die Solidität des staatlichen Haushalts ernsthaft gefährden und den Bund im Extremfall in die Nähe eines Staatsbankrotts bringen. Brunetti fordert deshalb unseres Erachtens zu Recht, dass systemrelevante Banken ihr Eigenkapital substanziell erhöhen müssen. Darüber hinaus fordert der marktwirtschaftlich orientierte Wissenschaftler die Abschaffung der Staatsgarantie sämtlicher Kantonalbanken. Sie sei wettbewerbsverzerrend.
«Die Gefahr ist gross, dass wir irgendwann in einer ähnlichen Situation landen wie bei der CS… Eine Schreinerei wird auch nicht vom Staat gerettet, wenn sie in Schwierigkeiten gerät.»
Anfang September legte die Expertengruppe «Bankenstabilität», die vom Ökonomieprofessor Yvan Lengwiler präsidiert wird, ihren Bericht mit Empfehlungen zum CS-Desaster vor. Sie kamen zu einem erstaunlichen Schluss: Ausser, dass die Finanzmarktaufsichtsbehörde FINMA gestärkt werden müsse, sieht sie keinen Handlungsbedarf – auch nicht in der Höhe des Eigenkapitals der Mega-UBS. Der Ökonom und ehemalige Mitarbeiter der Schweizerischen Nationalbank, Ariel Jost, reagierte in der «NZZ» vom 4. September mit Unverständnis: «Diesen Expertenbericht hätte auch die Bankiervereinigung schreiben können.» Jost fordert von der UBS eine harte Eigenkapitalquote von 30 Prozent – das Fünf- bis Sechsfache des heutigen Werts. Die Forderung des Experten mag hoch, aber nicht unberechtigt sein. So zeigt ein Stresstest des Internationalen Währungsfonds (IMF), dass von 900 in 29 Ländern untersuchten Banken jede dritte in die Bredouille kommen würde, sollte die Weltwirtschaft in eine Stagflations-Phase mit niedrigem Wachstum und hoher Inflation eintreten. Offenbar ist der Anteil schwacher Banken beträchtlich. Nichtsdestotrotz wird die mächtige Bankenlobby alles tun, um Forderungen nach signifikant höheren Eigenmitteln im Keim zu ersticken. Deshalb gilt wohl: Nach dem Knall ist vor dem Knall.
«Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.»
Als Vermögensverwalter sind wir bekanntlich Anhänger von Realwerten, zu denen in erster Linie Aktien gehören. In einem Umfeld stark erhöhter Inflation und potenziell steigender Zinsen stellt sich nun aber die Frage, ob Aktien immer noch die richtige Wahl sind. Die britischen Professoren Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton geben zu dieser Frage in ihrem von der Credit Suisse jährlich herausgegebenen «Global Investment Returns Yearbook 2023» interessante Hinweise. Darin zeigen die Forscher für die Zeitperiode von 1900 bis 2022 auf, dass Aktien in 95 Prozent aller untersuchten Subperioden, welche Phasen von sehr hoher bis sehr tiefer Inflation abdecken, besser abschneiden als Anleihen. Selbst in den Top-5-Prozent-Phasen, in denen die Inflation am höchsten ist, rentieren Aktien besser als Anleihen. Aktien würden in solchen Hochinflationsphasen aufgrund steigender Zinsen zwar auch an Wert verlieren, aber deutlich weniger als Anleihen. Dimson, Marsh und Staunton weisen darauf hin, dass Anleihen einzig in den extremsten 5-Prozent-Niedrigstinflationsphasen besser abschneiden als Aktien. Das war zum Beispiel in der Corona-Krise der Fall, als die Inflation in vielen Ländern um null herum lag oder sogar unter null sank und die Wirtschaft rezessiv war. Zwar steigen in solchen Extremphasen, die von tiefer Inflation, sinkenden Zinsen und oft auch einer Rezession begleitet sind, interessanterweise nicht nur die Anleihenkurse, sondern – eher kontraintuitiv – aufgrund steigender Bewertungen auch die Aktien. Nur sind die Zuwächse bei den festverzinslichen Papieren in solchen Phasen noch grösser als bei den Dividendenpapieren. Um es auf den Punkt zu bringen: Wer darauf wetten will, dass Anleihen besser abschneiden als Aktien, erwartet im Grunde eine Rezession mit sinkender Inflation und sinkenden Zinsen. Allerdings gestalten sich dafür die Wettchancen als nicht besonders günstig, denn dieses ohnehin kaum vorhersehbare Szenario trifft bekanntlich nur sehr selten ein.
Zugunsten von Anleihen kann ins Feld geführt werden, dass sie in der kurzen Frist sicherer sind als Aktien. Auch wenn wir seit der im Jahr 2022 eingesetzten Zinswende einen veritablen Bond-Crash erlebt haben, ist im Regelfall die Schwankungsbreite von Anleihen deutlich geringer als bei Aktien. Aber sind Aktien auch in der langen Frist riskanter als Anleihen? Um eine Antwort auf diese Frage zu erhalten, haben Dimson, Marsh und Staunton errechnet, wie lange auf realer, inflationsbereinigter Basis eine Durststrecke für Investorinnen und Investoren dauern kann, wenn sie ihr Geld ausgerechnet zur Unzeit auf einem historischen Höchststand anlegen. Mit anderen Worten: Wie lange dauert es, wenn man prozyklisch auf einem Höchststand investiert, bis man auf realer Basis wieder im Plus ist? Bezogen auf den Weltaktienmarkt und für den Betrachtungshorizont von 1900 bis 2022 war es so, dass die längste Phase für Aktionäre, inflationsbereinigt die zwischenzeitlichen Verluste wieder aufzuholen und die Nulllinie zu überschreiten, 22 Jahre betrug. Konkret: Wer zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Beginn der Grossen Depression der 1920er-Jahre zur Unzeit in Aktien eingestiegen ist, hat nach einem erdbebenartigen Börsenschock auf realer Basis nach 22 Jahren sein Geld wieder zurück gehabt.
Wer nun argumentiert, dass diese lange Durststrecke die nicht zu unterschätzenden Risiken von Aktien reflektieren würde, hat sicherlich nicht unrecht. Allerdings: Für Besitzer von Anleihen sieht es (noch) viel übler aus. Bezogen auf den Weltanleihenmarkt betrug nämlich die längste Durststrecke, auf realer Basis die zwischenzeitlichen Verluste wieder aufzuholen, abenteuerliche 82 (!) Jahre. Wer während der Grossen Depression sein Geld zur Unzeit in Anleihen steckte, musste über acht Jahrzehnte warten, bis er auf inflationsbereinigter Basis sein Geld zurück hatte. Deutsche Anleihen landeten damals im Bankrott. Es ist folglich eine Illusion zu glauben, Anleihen seien langfristig risikoärmer als Aktien – das Gegenteil ist der Fall, insbesondere wenn das Gespenst der Teuerung mit ins Kalkül einbezogen wird. Deshalb ist es auch keine gute Idee von Anlegerinnen und Anlegern, in inflationären Zeiten über viele Jahre übermässig viel Geld auf ihren Konti oder in Anleihen zu parken – sie werden durch die Teuerung eiskalt enteignet.
«Jetzt verstehen wir besser, wie wenig wir über Inflation verstehen.»
Der Traum vieler Investorinnen und Investoren ist es, in Hausse-Phasen im Aktienmarkt investiert zu sein, um sodann Baissen, wie wir sie insbesondere im Jahr 2022 erleben mussten, möglichst zu vermeiden. Dabei stellt sich die Frage, wie realistisch der Wunsch nach erfolgreichem Timing tatsächlich ist. Der Journalist Erich Gerbl hat in der Juli-Ausgabe des Wirtschaftsmagazins «Bilanz» anhand des amerikanischen Aktienmarktes S&P 500 und für die Zeit von 1928 bis 2022 aufgezeigt, dass es in der fast 100-jährigen Periode insgesamt 27 Bullenmärkte gab. Dabei hielt er sich an eine verbreitete Definition, dass ein Bullenmarkt so lange als Bullenmarkt gilt, bis der Aktienmarkt von einem einmal erreichten Höchststand um 20 Prozentpunkte korrigiert hat. In seiner Analyse stellte Gerbl fest, dass Bullenmärkte mit einer Dauer von 1'011 Tagen im Durchschnitt dreimal so lange dauern würden wie Bärenmärkte (diese dauern so lange, bis sich der Markt von einem einmal erreichten Tiefpunkt um 20 Prozentpunkte erholt hat), die im Durchschnitt «nur» etwa eine Länge von gut 300 Tagen aufweisen. Was sind die Gründe, dass Haussen offensichtlich viel länger dauern als Baissen?
Zwei Gründe sind dafür verantwortlich, die sehr wichtig für das Verständnis von Aktienbörsen und auch die Frage des Timings von Ein- und Ausstieg sind. Erstens: Wenn die Aktienmärkte einmal zu einer Korrektur ansetzen, geht es oft schneller respektive steiler runter als rauf. Dies liegt in der Natur des Menschen, der dazu neigt, in ökonomisch sowie politisch unruhigen Zeiten und angesichts sinkender Kurse in Panik zu geraten. Wenn Investorinnen und Investoren zum Ausgang rennen, rennen viele andere hinterher – der klassische Herdentrieb. Deshalb sind Baissen oft heftiger, aber kürzer als Haussen. Zweitens, und das ist der banalere, aber noch wichtigere Grund, dass Haussen länger dauern als Baissen: Langfristig steigen Aktienmärkte! Wachsende Volkswirtschaften, produktive Unternehmen und damit eine hohe Wertschöpfung sorgen dafür, dass Aktienmärkte in der langen Frist steigen. Mit anderen Worten: Haussen müssen im Durchschnitt länger dauern als Baissen, sonst kann der langfristige Trend von Aktienmärkten – und das wird auch in Zukunft so bleiben, wenn die Welt nicht untergeht – schwerlich steigend sein. Aufgrund dieser bedeutenden Tatsache vergleichen wir notorische Crash-Propheten gerne mit Schwimmern, die in Rotterdam in den Rhein springen und versuchen, rheinaufwärts (in Richtung Basel) schneller zu schwimmen als jemand, der die Strecke flussabwärts (also von Basel in Richtung Rotterdam) in Angriff nimmt. Wer auf Baissen setzt, schwimmt flussaufwärts, braucht viel mehr Kraft und wird das Rennen gegen den Strom auf Dauer garantiert verlieren – das ist mutig, wenn nicht sogar übermütig. Wer mit der Hoffnung auf gutes Timing versucht, eine Baisse zu vermeiden und aus den Aktienmärkten aussteigt, ist ein Spekulant, der auf Dauer scheitern wird. Dies nicht zuletzt deshalb, weil in effizienten Märkten eine Prognose, wann genau eine Baisse einsetzen und wann sie enden wird, schlicht unmöglich ist. Aus diesem Grund bleiben wir, zumindest mit einem Grossteil der Anlagen, immer strategiekonform investiert und profitieren langfristig vom Treiben des Wassers.
«Wenn Du es liebst, ständig zu kaufen und zu verkaufen, dann möchte ich Dein Broker sein – aber nicht Dein Partner.»
Dass das Finden des perfekten Timings für den Ein- und Ausstieg ein Ding der Unmöglichkeit ist, unterstreicht eine Studie der Investmentbank Goldman Sachs. Wer von 1900 bis 2022 im amerikanischen S&P 500 investiert war, erzielte in dieser Zeit eine Durchschnittsrendite von jährlich 9,8 Prozent. Wer aber jeweils den besten Monat eines Jahres verpasste, schaffte es bloss auf eine jährliche Durchschnittsrendite von 1,8 Prozent. Wenn auch die Grundlage der Untersuchung etwas hypothetisch anmutet, so zeigt sie doch auf, dass aggressives Timing brandgefährlich sein kann, weil man riskiert, die beste Zeit zu verpassen. Wir können Ihnen versichern: Wer an Timing-Künste glaubt und aussteigt, um Verluste zu vermeiden, vermeidet in der Regel nicht Verluste, sondern verpasst im Gegenteil satte Gewinne. Auch dies liegt in der menschlichen Psyche: Die meisten Investorinnen und Investoren verkaufen in Panik, wenn die Märkte aufgrund miserabler politischer oder wirtschaftlicher Nachrichten am Taumeln sind. In der Folge wollen sie erst wieder einsteigen, wenn sich der trübe Börsenhimmel aufgehellt hat. Das ist prozyklisch und immer viel zu spät, denn nach ihrem angstgetriebenen Ausstieg steigen die Aktien bereits wieder an, wenn nur schon ein schwaches Lichtlein am Ende des Tunnels zu erkennen ist. Aktien erreichen dann ihren Tiefpunkt, wenn die Aussichten am trübsten sind. Wenn die Sonne wieder scheint und der Himmel wolkenlos ist, erreichen sie neue Höchststände.
«Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten, und schauen Sie alle Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich.»
Nachdem wir uns in unserem Kundenschreiben von Anfang Juli zurückhaltend zu Schwellenmarktanlagen geäussert haben, wollen wir unserer kritischen Sicht nochmals Nachdruck verleihen. Die unumstrittene Lokomotive unter den Emerging Markets ist China. Nach dem Ende der Null-Covid-Politik war sich die Anlegerwelt einig, dass das Reich der Mitte im Jahr 2023 eine Auferstehung erleben würde. Sie wurde arg enttäuscht – die Wirtschaft der Volksrepublik kommt schlicht nicht in die Gänge. Entscheidend für die Beurteilung von Schwellenmarktanlagen ist aber die lange Frist. Im «Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2023» geben die britischen Professoren Elroy Dimson, Paul Marsh und Mike Staunton einen repräsentativen Überblick über die Performance von Emerging Markets im Vergleich zu den etablierten Westmärkten. Wer in der Zeitperiode von 1900 bis 2022 in Aktien der Emerging Markets investiert hat, erzielte eine jährliche Performance von 6,8 Prozent – aus USD 1 resultierte ein Endvermögen von USD 3'249. In derselben Periode warfen Aktien der entwickelten Industrieländer jährlich 8,2 Prozent ab – aus USD 1 resultierte ein Endvermögen von USD 16'505, also das Fünffache. Dazu kommt, dass die Schwankungsrisiken von Schwellenmarktaktien erst noch höher sind als diejenigen von Aktien der Industrienationen. Nicht besser sieht es bei Anleihen der Schwellenmärkte aus. Sie warfen in der langen Frist eine jährliche Rendite von 2,6 Prozent ab – aus USD 1 resultierte ein Endvermögen von gerade einmal USD 23. Im Vergleich dazu rentierten Anleihen der entwickelten Länder mit jährlich 4,5 Prozent – aus USD 1 wurden am Ende USD 217 und somit fast das Zehnfache.
«Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn.»
Die sogenannten Brics-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) bemühen sich seit längerer Zeit, eine eigene Brics-Handelswährung als Konkurrenz zum Dollar ins Leben zu rufen. Immerhin leben 40 Prozent der Weltbevölkerung in diesen Staaten, die rund 26 Prozent des globalen Bruttoinlandprodukts stellen. Hat das Projekt eine Chance? Der britische Ökonom Jim O’Neill, der kurz nach der Jahrtausendwende die Abkürzung Bric (Südafrika kam erst später dazu) prägte, meldete sich im August in der «Financial Times» zu Wort. Obwohl er die Vorherrschaft des Dollars nicht unkritisch sieht, fragt er an die Adresse der Brics-Staaten: «Wollen sie eine Brics-Zentralbank schaffen? Wie das?» O’Neill bezeichnet das Projekt als «lächerlich», denn seit ihrem ersten Treffen im Jahr 2009 hätten die Brics schlicht «nichts erreicht» – ein vernichtendes, aber wohl realistisches Fazit. Dieses wird noch bekräftigt, wenn man einen Blick auf die sechs Länder wirft, die per 1. Januar dieses Jahres zum Brics-Klub dazugestossen sind: Es sind dies Saudi-Arabien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate, Argentinien, Ägypten und Äthiopien. Insgesamt sollen rund 40 Länder ein Interesse an einem Beitritt haben. Dass aus einem Gruselkabinett besonders menschenverachtender Gewaltherrschaften eine Währung gezaubert werden kann, die das Vertrauen von Investoren verdient, ist nach unserer Überzeugung reine Utopie.
Die Schweizerische Nationalbank (SNB) schrieb in ihrem Ende Juni veröffentlichten Finanzstabilitätsbericht, Einfamilienhäuser und Stockwerkeigentum seien zwischen 15 und 40 Prozent überbewertet. Trotzdem bestand für die Anhänger von «Betongold» lange die Hoffnung, dass die Immobilienpreise im Kontrast zu Anleihen und Aktien von der eingetretenen Zinswende verschont bleiben würden. Nun mehren sich die Stimmen, dass die Blase, die sich in etlichen Regionen der Schweiz gebildet hat, Luft ablässt. Die Hoffnung auf eine Fortsetzung der langjährigen Hausse ist zwischenzeitlich sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland geplatzt. So zeigt sich, dass sich auch Renditeliegenschaften der Schwerkraft der Zinsentwicklung nicht entziehen können. Gemäss dem Beratungsunternehmen Fahrländer Partner haben die Preise für Immobilien in der Schweiz um deutlich über 10 Prozent korrigiert – das gilt gleichermassen für Mehrfamilienhäuser, Büroliegenschaften und gemischte Nutzungen. Am Kapitalmarkt bestätigt sich dieses Bild: Ein Grossteil der Immobilien-Fonds und -Aktiengesellschaften werden an der Börse mit einem starken Abschlag gegenüber dem ausgewiesenen Inventarwert gehandelt – noch vor zwei Jahren war es umgekehrt. Zu hohe buchhalterische Werte werden in Zukunft wohl nach unten angepasst werden müssen.
«Es war völlig klar, dass diese Trendwende kommen würde, wir wussten bloss nicht wann.»
Andreas Loepfe, Immobilienökonom und CEO des Beratungsunternehmens Inreim, liess in der «NZZ am Sonntag» durchblicken, dass Transaktionen mit Mehrfamilienhäusern und Büroimmobilien je nach Schätzung um 50 bis 80 Prozent eingebrochen seien: «Versicherungen und auch andere institutionelle Investoren haben ihre Anlagen in Schweizer Immobilien heruntergefahren oder vorläufig sogar ganz eingestellt.» Tatsächlich ist von vielen Marktkennern zu hören, dass ein Verkauf eines Objekts anspruchsvoller geworden ist und es oft viel länger dauert, bis ein Käufer – nicht selten mit Preisnachlässen – gefunden wird.
Ob die Korrektur an den Immobilienmärkten damit bereits einen Boden gefunden hat, ist zumindest fraglich. So hat sich die Erhöhung der Leitzinsen bis jetzt noch kaum spürbar auf die Belastung der Hypothekarschuldner ausgewirkt, da diese ihre Kredite noch zu tiefen Zinsen aufnehmen konnten. Gemäss dem Bundesamt für Wohnungswesen lag im vergangenen Jahr die durchschnittliche Zinslast auf alle laufenden Hypotheken noch bei 1,5 Prozent. Müssen diese inskünftig bei Sätzen von 3 oder mehr Prozent erneuert werden, droht eine sogenannte «Refinanzierungsmauer» respektive eine Verdoppelung der Zinslast. Im laufenden Jahr werden laut dem Immobilienberater Moneypark um die CHF 130 Mrd. an Hypotheken erneuert, auf welche bislang nur gerade 1,4 Prozent an Zinsen bezahlt werden. Sodann werden im Jahr 2025 CHF 130 Mrd. und im Jahr 2026 CHF 140 Mrd. zur Erneuerung fällig, die im Durchschnitt zu 1,35 respektive 1,3 Prozent verzinst werden. Innerhalb von drei Jahren wird mit CHF 400 Mrd. somit ein Drittel des gesamtschweizerischen Hypothekarvolumens zur Erneuerung fällig. Dieses reflektiert mit CHF 1'200 Mrd. das Anderthalbfache des schweizerischen BIP, was Weltrekord bedeutet – wir Schweizer sind zwar bewunderte Vorbilder bei den Staatsschulden, bei privaten Schulden hingegen lieben wir das Risiko. Es liegt auf der Hand: Die Zinswende kommt im Immobilienbereich mit Verzögerung an – dies aber mit Bestimmtheit. Das birgt Risiken nicht nur für Eigenheimbesitzer, sondern auch für kreditgebende Banken.
«Insgesamt ist der Wohnimmobilienmarkt anfällig – die Preisempfindlichkeit gegenüber Schocks ist erhöht.»
Wir erinnern uns: In den 1990er-Jahren gingen im Zuge einer monumentalen Immobilienkrise unzählige Kantonal- und Regionalbanken unter oder wurden übernommen. Zwangsversteigerungen häuften sich und viele Banken wurden unfreiwillig zu Eigentümern von Büro-, Einfamilien- sowie Mehrfamilienhäusern, Gewerbebauten und Hotels. Auch wenn die Banken heute betonen, sie hätten aus der Geschichte gelernt, beobachtet die schweizerische Aufsichtsbehörde FINMA gemäss einem Beitrag der «Zuger Zeitung» vom 9. Oktober seit geraumer Zeit, dass etliche Banken nicht nachhaltige Vergabekriterien für Hypotheken anwenden würden. So würden sie die Tragbarkeitsrichtlinien der Kreditnehmenden tendenziell verletzen. Bei einem Zins von 3 Prozent sähen gemäss FINMA 20 bis 30 Prozent aller neuen Hypotheken wackelig aus, weil sämtliche Mieteinnahmen dafür verwendet werden müssten, um die Hypothekarzinsen zu bezahlen. Das sind wahrlich düstere Perspektiven, die es im Auge zu behalten gilt. Wir können es nicht genug betonen: Überschätzen Sie nicht die realistisch zu erzielende Nettorendite nach Abzug von Unterhalts- und Sanierungsbeiträgen, unterschätzen Sie nicht die effektiven Risiken ihres Wohneigentums und sorgen Sie dafür, dass Sie immer konservativ finanziert sind – nicht, dass Sie im dümmsten Moment von Ihrer Bank unter Druck gesetzt werden, um Ihre Hypotheken zu amortisieren. Eine tiefe oder gar keine Fremdfinanzierung sorgt für Beruhigung. Ähnlich wie bei Aktien gilt auch bei Immobilien das Motto: Die Unabhängigkeit von Banken und Bankern ist von fundamentaler Bedeutung.
«Ein Bankier ist ein Mensch, der seinen Schirm verleiht, wenn die Sonne scheint, und ihn sofort zurückhaben will, wenn es zu regnen beginnt.»
Bereits grösser ausgefallen als in der Schweiz sind gemäss Experten die Preiskorrekturen in Deutschland, Italien, Australien, Kanada und in den Vereinigten Staaten von Amerika, die mit weit höheren Zinsen und Inflationsraten zu kämpfen haben. Wie schwierig das Terrain im Immobilienmarkt Deutschland ist, zeigt das Beispiel des Immobilieninvestors Peach Property. Das Unternehmen investiert vor allem in Mietwohnungen sogenannter B-Städte in Deutschland. Über 90 Prozent des EUR 2,5 Mrd. umfassenden Portfolios sind in mehr als 27'500 Wohnungen investiert. Die Aktie von Peach Property hat seit ihrem Höchststand im Jahr 2021 über 80 Prozent ihres Kurswertes verloren und notiert nahe an ihrem Allzeittief.
Die Europäische Zentralbank (EZB) warnte Ende Mai im Zuge der Zinswende vor einer «ungeordneten Korrektur» der Immobilienpreise. Die Weltbank wiederum sorgt sich um europäische Immobilienfirmen, die in den kommenden Jahren ausstehende Schulden im Gegenwert von CHF 165 Mrd. zu deutlich höheren Zinssätzen erneuern müssen. Geradezu spektakulär erscheint in diesem Zusammenhang der Kollaps der Signa Holding rund um den österreichischen Immobilienmogul und Wunderwuzzi René Benko. Erstaunlich an diesem Fall ist die Tatsache, dass sich erfolgreiche Persönlichkeiten wie Klaus-Michael Kühne (Kühne und Nagel), Ernst Tanner (Lindt & Sprüngli), der Thurgauer Kaffeemaschinenhersteller Arthur Eugster, der deutsche Fressnapf-Gründer Torsten Toeller, der österreichische Baulöwe Hans Peter Haselsteiner und der deutsche Unternehmensberater Roland Berger vom intransparenten und mit Milliardenkrediten in luftige Höhen gehebelten Konstrukt dieses Kaufhaus-Zampanos blenden und verführen liessen. In Schweden ist der Immobilienkoloss SBB schon im vergangenen Mai in Schieflage geraten. In den USA sind viele Häuserpreise um rund 20 und Büroliegenschaften um 30 Prozent eingebrochen. Geradezu aus den Fugen geraten ist der Immobilienmarkt im krisengeschüttelten China. Der bereits vor zwei Jahren ins Wanken geratene Immobilienentwickler Evergrande beantragte im August Gläubigerschutz. Gleichzeitig kam auch die mit USD 194 Mrd. verschuldete Country Garden in die Bredouille. In China, wo 70 Prozent der Privatvermögen in Immobilien stecken, sollen rund 100 Millionen Wohnungen leer stehen. Weil in der Volksrepublik der Boden einzig und allein dem Staat gehört, können Privatpersonen und Unternehmen nur Nutzungsrechte erwerben. Da aber erfahrungsgemäss der Baugrund der langfristig wertvermehrende Faktor einer Immobilie darstellt und nicht der Beton, ist in China der Druck auf die Häuserpreise besonders gross.
«Die Blase am Immobilienmarkt in China hat sich über eine lange Zeit hinweg entwickelt, sie ist eine der grössten in der Geschichte.»
Erinnern Sie sich an die unzähligen osteuropäischen Häuslebauer, die in der Zeit der Finanzkrise Kredite im tiefverzinslichen Schweizer Franken aufnahmen, um damit ihre Wohnungen und Häuser in Polen und Ungarn zu finanzieren? Damit glaubten sie, besonders schlau zu sein, denn die Hypothekarzinsen in Schweizer Franken liegen notorisch um mehrere Prozentpunkte tiefer als diejenigen in Forint oder Zloty. Damals wurden in Polen und Ungarn bis zu 80 Prozent aller Kredite in Schweizer Franken vergeben – mit fatalen Folgen für die Eigenheimbesitzer. Bis zur Rückzahlung der Hypothekarkredite werteten sich nämlich sowohl der ungarische Forint als auch der polnische Zloty um die Hälfte gegenüber dem Schweizer Franken ab. Die ungarischen und polnischen Häuslebauer mussten in der Folge doppelt so viele Forint und Zloty aufwenden, um ihren Franken-Kredit zurückzuzahlen. Der Zinsvorteil war mehr als aufgebraucht und der Wert ihrer Wohnung oder ihres Hauses deckte den Franken-Kredit nicht mehr. Viele Eigenheimbesitzer rasselten in die Pleite. Sie missachteten die simple Regel der Zinsparität: Währungen, in denen die Inflation und damit auch das Zinsniveau hoch sind, sind langfristig schwach. Forint und Zloty schwächen sich nach dieser simplen Logik langfristig in der Höhe der Zinsdifferenz zum Schweizer Franken ab. Wäre dem nicht so, könnten wir risikolos Geld verdienen, indem wir Kredite zu 3 Prozent in Schweizer Franken aufnehmen und diese zu 5 Prozent in Dollar oder zu 23 Prozent in türkischer Lira anlegen würden.
«Wohnungen sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren.»
Trotz dieser Gesetzmässigkeit wiederholt sich die Geschichte gerade in ähnlicher Form. Viele Investorinnen und Investoren verschulden sich in Schweizer Franken und insbesondere im japanischen Yen, um das geborgene Geld höherverzinslich anzulegen. In Japan verharren die Zinsen aufgrund der persistenten Tiefzinspolitik der Bank of Japan, ganz im Gegensatz zu Regionen wie die Vereinigten Staaten von Amerika oder Europa, nahe an der Nulllinie. Das auf Pump aufgenommene Geld wird sodann in höherverzinsliche Währungen im osteuropäischen und südamerikanischen Raum angelegt. Für Anleger, die sich in Yen zu 1 Prozent verschulden und den Gegenwert zu 11 Prozent in kolumbianischen Peso anlegen, war das in jüngerer Vergangenheit ein Bombengeschäft. So haben sowohl der kolumbianische als auch der mexikanische Peso im abgelaufenen Jahr gegenüber dem Schweizer Franken stark zugelegt. Auch der polnische Zloty und der ungarische Forint haben deutliche Zuwächse verzeichnet. Die Strategie, tiefverzinsliche Kredite aufzunehmen und diese in höherverzinslichen Währungen anzulegen, wird in der Fachsprache als Carry Trade bezeichnet. Ob das Spiel der Carry Trader diesmal gut enden wird? Wir haben unsere Zweifel. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich das Carry-Trade-Blutbad wiederholt, denn für die notorischen Schwachwährungen aus Kolumbien, Mexiko, Polen oder Ungarn gilt naturgemäss das Gesetz der Schwerkraft. Dieses besagt, dass sie aufgrund hoher Inflation und Zinsen langfristig zur Schwäche neigen. Für viele Carry Trader und Hedge Funds wird es ein böses Erwachen geben, wenn ein Währungszerfall die Zinsgewinne ausradieren wird.
Gezockt wird auch mit Kryptowährungen. Aus früheren Kundenbriefen sowie publizierten Fachartikeln kennen Sie unsere Meinung zu digitalem Geld. Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert, wirft weder einen Zins noch eine Dividende ab und reflektiert einzig die Hoffnung, dass einem jemand die gekauften Coins zu einem höheren Preis abkauft – despektierlich wird diese Art von Hoffnung auch als «Greater-Fool-Phänomen» bezeichnet. Man hofft auf einen noch Verrückteren, der einem das digitale Geld mit Gewinn abnimmt. Nun ist als erste Staatsbank der Schweiz die Zuger Kantonalbank, über die wir als Depotbank zahlreicher unserer Kunden eine vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit pflegen, in das Geschäft mit Kryptowährungen eingestiegen. Kunden können über die Bank seit dem 1. Oktober Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Polygon, Ripple und Uniswap kaufen sowie verwahren lassen. Auf die Frage, was die Gründe der Bank sind, ins Kryptogeschäft einzusteigen, liess sich ihr CEO, Hanspeter Rhyner, in der «Finanz und Wirtschaft» wie folgt zitieren: «Die Anfragen zu Investitionen in digitale Assets haben sich in letzter Zeit gehäuft» – insbesondere auch bei Privatinvestoren. Die Antwort ist erfrischend ehrlich und entlarvend zugleich. Banken bieten nicht in erster Linie Anlagen und Produkte an, von denen sie auch selber überzeugt sind, sondern was gerade Mode ist und nachgefragt wird. Ob eine Anlage aus Investorensicht sinnvoll ist oder nicht, ist von zweitrangiger Bedeutung. Mit dem Kryptoangebot will die Zuger Kantonalbank ihr Kommissionsgeschäft steigern. Gemäss Pressebericht betragen die Gebühren auf Transaktionen von bis zu CHF 50'000 lukrative 1,3 Prozent. Während die Luzerner Kantonalbank ihre Kunden seit Jahresbeginn ebenfalls mit Kryptoanlagen beglückt, arbeitet die PostFinance an einem Angebot für ihre 2,5 Millionen Kunden ab dem Jahr 2024. Ufff, wenn das nur gut geht. Definitiv nicht gut steht es um die im Crypto-Valley Zug domizilierte Kryptohandelsplattform SmartValor, die im Februar 2022 mit viel Marketinglärm an die Börse gegangen ist. Seither haben Anleger satte 97 Prozent ihres Geldes verloren. Die Hoffnung auf Besserung stirbt bekanntlich zuletzt.
«Niemand war je in der Lage, die Börse vorherzusagen. Es ist eine totale Zeitverschwendung.»
Was ist nun für das gerade begonnene Börsenjahr an Rendite zu erwarten? Sie wissen es: Wir wissen es nicht, denn von kurzfristigen Prognosen halten wir nichts. Bleiben wir aber realistisch, was unsere Renditeerwartungen anbelangt. Aufgrund der Aufzeichnungen der Genfer Privatbank Pictet, die bis ins Jahr 1926 zurückgehen, wissen wir, dass Schweizer Aktien in gut 73 Prozent aller Jahre eine positive Rendite abwarfen. Immerhin in mehr als jedem vierten Kalenderjahr hatten die Renditen von Schweizer Aktien aber ein negatives Vorzeichen. Es sind genau diese negativen Resultate, die wir aushalten müssen – im Nichtwissen, wann sie eintreten. Sie sind der Preis für die langfristig überragende Rendite von Schweizer Aktien, die über die Zeitperiode von 97 Jahren nominal bei jährlich 7,7 Prozent und real bei 5,6 Prozent lag – bei Anleihen waren es jährlich 3,9 respektive 2,0 Prozent. Vergleichen wir diese historischen Renditen mit den subjektiven Renditeerwartungen von 8'550 Privatanlegern, die von Natixis Investment Managers, einem französischen Vermögensverwalter, befragt wurden, so ergibt sich eine erschreckende Diskrepanz. Während Schweizer Privatinvestoren langfristig eine bereits utopische Realrendite von jährlich 9,6 Prozent erwarten, liegt der entsprechende Wert bei den befragten internationalen Anlegern bei sagenhaften 12,8 Prozent – nominal liegen diese Werte sogar noch um rund 2 Prozentpunkte höher. Das ist natürlich kolossales, unvernünftiges Wunschdenken und jenseits jeglicher Realität.
Wenn Sie nun glauben, zu hohe Renditeerwartungen seien «nur» der Naivität von uninformierten Privatanlegern geschuldet, täuschen Sie sich. Auch Schweizer Lebensversicherer – die bekannteste ist Swiss Life – versprechen massiv höhere Renditen, als ihre Kunden eigentlich erwarten dürften. Dies geht aus einer Medienmitteilung der Finanzmarktaufsicht FINMA von Ende August hervor. Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen seien die Renditeversprechen systematisch zu hoch, wie die Untersuchung der FINMA für die Zeitperiode von Januar 2020 bis März 2021 bei insgesamt 85'000 Versicherungsabschlüssen ergeben hat. «Über 90 Prozent der von der FINMA untersuchten Beispielrechnungen weisen teilweise weit zu optimistische Renditeentwicklungen aus», sagt ad-interim-Direktorin Birgit Rutishauser. Ganz besonders gelte dies für ungünstige Szenarien, die aufzeigen sollten, wie hoch die Rendite ausfällt, wenn starke Zinsanstiege oder Börsenkorrekturen auf die Performance drücken. «Die Versicherer wiesen hier im Untersuchungszeitraum sogar bei der Annahme eines schlechten Verlaufs der Anlage Werte aus, die weit über der risikolosen Rendite liegen», so Rutishauser. So hätten einige Versicherer in diesem üblen Szenario eine Rendite von 3,5 Prozent in Aussicht gestellt, obwohl der risikofreie Zins im gleichen Zeitraum negativ war. Mit Verlaub: Das ist nicht nur schönfärberisch, sondern schlicht unseriös.
«Die Welt will betrogen werden, also betrügen wir sie – das wussten schon die alten Römer.»
Eine fragwürdige Praxis bezüglich erwarteter oder erzielter Renditen treffen wir leider regelmässig auch in der Banken- und Vermögensverwalterwelt an. Bei potenziellen Neuakquisitionen stehen wir bekanntlich im harten Wettbewerb mit Gross-, Privat- und Kantonalbanken sowie unabhängigen Vermögensverwaltern. Private und vor allem institutionelle Investoren wie Pensionskassen wollen vor einer möglichen Zusammenarbeit jeweils wissen, wie hoch denn unsere zu erwartende Rendite für die Zukunft und unsere Performance in der Vergangenheit ausgefallen sei. Es ist für uns eine Frage der Ehre, der Ehrlichkeit und des Anstandes, realistische und wahrheitsgetreue Angaben und Versprechen zu machen. Das sind wir unseren Kundinnen und Kunden schuldig, auch wenn wir mit dieser Haltung zu den Ausnahmen in der Branche gehören. Da wird geblufft, geprahlt, beschönigt und gelogen, dass sich die Balken biegen. Ein Beispiel: Bei einer im Grunde seriösen Bank führen wir einige Mandate von Kunden, die sowohl von der Bank wie auch von uns seit vielen Jahren ein Portfolio verwalten lassen. Von diesen Kunden erfahren wir jeweils am Jahresende, wie unsere Wettbewerber bezüglich Performance abgeschnitten haben. Diese Renditen notieren wir fein säuberlich in unseren Akten, um einen langjährigen Vergleich unserer Anlageleistung mit der Konkurrenz zu erhalten.
Vor einiger Zeit interessierte sich eine Unternehmerpersönlichkeit für unsere Dienstleistung. Im Gespräch teilte sie uns mit, dass ihre Entscheidung für die Vergabe eines Mandates zwischen uns und der besagten Bank fallen würde. Was wir im Verlauf des Akquisitionsprozesses mit blankem Erstaunen feststellten, war geradezu abenteuerlich. Die von der Bank für die Vergangenheit angegebenen Performance-Zahlen lagen in einzelnen Jahren um glatte 10 Prozentpunkte (!) über dem, was sie gemäss unseren Aufzeichnungen tatsächlich erzielt hat – eine ungeheuerliche Schönung der Tatsachen. Leider stellen wir diese Praxis öfters fest – potenzielle Kunden werden für dumm verkauft. Wir können es nicht genug betonen: Selbstverständlich ist die Performance eines Vermögensverwalters am Ende des Tages von vorrangiger Bedeutung und Ausfluss einer erfolgreichen Anlagephilosophie. Aber wählen Sie einen Geldmanager niemals aufgrund seiner Renditeversprechen oder aufgrund seiner angeblich in der Vergangenheit erzielten Renditen aus. Die Wahrscheinlichkeit, dass er Fakten negiert, verzerrt und beschönigt, ist hoch – zumal es in einer Bank in der Regel eine einheitlich messbare Strategie schon gar nicht gibt, weil oft eine «Wünsch-Dir-was-Politik» gegenüber den Kunden praktiziert wird. So antwortet der CIO der Zürcher Kantonalbank in einem gesponserten Interview mit der «NZZ» auf die Frage, wie viele Anlagestrategien die ZKB für die unterschiedlichen Risikoprofile denn habe: «Mittlerweile haben wir rund 2'300…» 2'300 Anlagestrategien! Da wird es naturgemäss immer ein paar Strategien geben, die in einer bestimmten Zeitperiode überdurchschnittlich gut abschneiden. Um es auf den Punkt zu bringen: Wenn Sie 20 Banken und Vermögensverwalter fragen, ob sie in der Vergangenheit eine überdurchschnittliche Anlageleistung erbracht haben oder nicht, werden ihnen mutmasslich 100 Prozent der 20 Dienstleister bestätigen, dass sie zumindest zur besseren Hälfte, vermutlich sogar zu den besten 20 Prozent aller Anbieter gehören würden. Das Resultat dürfte noch viel eindrücklicher ausfallen als bei Umfragen, die ermitteln, wie Autofahrer ihre Fähigkeiten im Quervergleich mit der Durchschnittsbevölkerung einschätzen. Bei dieser Befragung sind es «nur» etwa 80 Prozent, die von sich behaupten, sie würden überdurchschnittlich gut Auto fahren – auch dies natürlich eine statistische Unmöglichkeit.
«Die Statistik ist wie eine Laterne im Hafen. Sie dient dem betrunkenen Seemann mehr als Halt als zur Erleuchtung.»
Bleiben wir auf dem Boden und vor allem ehrlich, was unsere Erwartungen an die zukünftig zu erwartende Rendite anbelangt. Während in der Referenzwährung Schweizer Franken mit Aktien eine nominelle Rendite (Kurssteigerungen plus Dividenden) von jährlich 6 bis 8 Prozent – real entspricht dies rund 4,5 bis 6,5 Prozent – realistisch erscheint, darf bei qualitativ erstklassigen Anleihen mit nominell 1,0 bis 1,5 Prozent – real entspricht das einer schwarzen Null – gerechnet werden. In der Referenzwährung Euro liegen die Renditeerwartungen um gut 1 Prozent höher, weil parallel dazu auch das Zinsniveau höher liegt. Um es im Jargon des schweizerischen Nationalsports «Jassen» respektive dem beliebten «Differenzler» auszudrücken: Wir sagen lieber realistisch an, um am Ende nicht an einer zu grossen Differenz zu scheitern.
Auch im Umgang mit dem Thema nachhaltiger Anlagen ist Realitätssinn gefordert. In früheren Kundenbriefen haben wir uns ausführlich zur ESG-Thematik und zur Problematik des Greenwashing geäussert. Nun hat gemäss Berichten der «Schweiz am Wochenende» und der «Zuger Zeitung» die schweizerische Post eines der grössten privaten Waldgebiete Thüringens im Umfang von 2'400 Hektaren gekauft. Der Staatskonzern hat sich zum Ziel gesetzt, ab 2023 klimaneutral zu sein. Der Verkäufer des Waldes ist Prinz Michael von Sachsen-Weimar-Eisenach. Seine Tochter, Prinzessin Leonie, möchte sich nicht mehr mit dem Zillbacher Forst, der aus Kiefern, Lärchen, Fichten und Buchen besteht, abmühen. Gemäss Presseberichten erhielt der Prinz für den Verkauf rund EUR 60 Mio., was das Mehrfache des von Marktbeobachtern geschätzten Werts reflektiert. Die Post geht davon aus, dass durch das deutsche Waldengagement jährlich an die 9'000 Tonnen Kohlendioxid (CO2) gebunden werden könnten. Nun wurde im September publik, dass das Waldstück bereits in der Klimabuchhaltung Deutschlands eingerechnet sei – es besteht somit der Verdacht, dass doppelt gezählt wird. Was die schweizerische Post betreibe, sei «übelstes Greenwashing», sagte denn auch Sebastian Rüter vom Hamburger Thünen-Institut für Holzforschung der deutschen Wochenzeitung «Die Zeit» – die Post spricht ihrerseits lieber von «unterschiedlichen Bilanzkreisen». Was die Post unter «unterschiedlichen Bilanzkreisen» genau versteht und was sie antreibt, in Deutschland Waldwirtschaft zu betreiben, entzieht sich unserer Kenntnis. Fest steht, dass sich die Umwelt durch ihren Erwerb kaum verbessert, denn der Wald hat vorher schon bestanden – einfach unter einem anderen Besitzer.
Eine hartnäckig hohe Kerninflation, eine weltweit immer höhere Staatsverschuldung, ein erstaunlich robuster Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten von Amerika und der Wegfall der Anleihenkäufe des Fed haben im vergangenen Jahr dazu beigetragen, dass die Zinsen der führenden Industriestaaten im Jahresverlauf kräftig angezogen haben. In Europa und in den USA sind die Zinssätze auf das Niveau von 2007 zurückgekehrt. Von einer wirtschaftlichen Abschwächung oder gar einer Rezession, wie sie viele Auguren zu Beginn des Jahres 2023 erwartet haben, ist bisher wenig zu spüren. Als Folge davon erreichten 10-jährige Staatspapiere in den USA zwischenzeitlich ein Zinsniveau von rund 5, in Deutschland rund 3 und in der Schweiz immerhin wieder deutlich über 1 Prozent. Es ist noch nicht lange her, seit diese Sätze nahe bei null oder sogar negativ notierten. Als Folge dieses Zinsanstiegs konnte ein veritabler Anleihen-Crash beobachtet werden. Wer im Frühjahr 2020 20-jährige US-Staatsanleihen kaufte, hat zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent seines Einsatzes verloren. Zum Vergleich: Der amerikanische Aktienmarkt verlor in der historischen Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009 mit 55 Prozent nur unwesentlich mehr. Wer sich auf der Jagd nach positiver Rendite im Sommer 2020 entschied, 100-jährige österreichische Staatsanleihen zu kaufen, hat vom erreichten Höchststand sogar rund 70 Prozent verloren. Unser Fokus auf Anleihen mit erstklassiger Bonität und kurzen bis mittleren Laufzeiten hat unsere Kunden vor derartigen Schäden bewahrt.
«Der Gescheitere gibt nach! Eine traurige Wahrheit. Sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit.»
Per Mitte Dezember (Drucklegung des vorliegenden Kundenbriefs) lässt sich sagen, dass zwar kein berauschendes, aber durchaus ordentliches Anlagejahr hinter uns liegt. Die Euphorie nach den Verlusten des Vorjahres, die die Märkte zu Beginn des Jahres versprühten, legte sich im Laufe des Jahres einerseits deshalb, weil sich die hohe Inflation als hartnäckiger erweist als erhofft. Andererseits akzentuierten sich die Ängste der Anleger, als die Hamas im Oktober überraschend Israel angriff. In der Folge gerieten die Aktienmärkte unter Druck. Aus unserer Perspektive erfreulich ist die Tatsache, dass wir nach dem rekordverdächtigen Vorsprung, den wir im relativen Vergleich zu relevanten Indizes und Wettbewerbern im Jahr 2022 erzielen konnten, mit unserer Aktienauswahl auch im Jahr 2023 überzeugten – trotz dem Boom hoch bewerteter und riskanter Technologiewerte, die wir untergewichtet halten. Im Hinblick auf die (unsicheren) Zukunftsaussichten ist positiv zu werten, dass die Zinsen in den vergangenen zwei Jahren kräftig angezogen haben. Erstens werfen festverzinsliche Anlagen wieder einen signifikanten Zins ab – wenn auch real nicht viel übrig bleibt. Zweitens, und das ist das Entscheidende, hat sich durch die seit 2022 eingesetzte Aktienkorrektur auch die Bewertung der Dividendenpapiere an das höhere Zinsniveau angepasst. Tiefere Aktienbewertungen bedeuten in der Folge höhere Renditeerwartungen für die Zukunft. Im Grunde wussten wir alle, als die Zinsen für Jahre im negativen Bereich verharrten, dass irgendeinmal die Zinsen steigen und wir durch das Tal der Tränen gehen müssen. Steigende Inflation und Zinsen drücken vorübergehend auf die Bewertung – nur wusste niemand, wann dies der Fall sein würde. Dieser schmerzliche Prozess erfasst erfahrungsgemäss zuallererst die liquiden Kapitalmärkte der Anleihen und Aktien. Mit Verzögerung erfolgt der Anpassungsprozess auch bei illiquiden Segmenten wie Immobilien und Private Equity. Bei aller Unwissenheit, was die Zukunft bringen wird, macht uns das bezüglich der mittel- und längerfristigen Aussichten für Aktien optimistisch – nicht zuletzt auch deshalb, weil die führenden Notenbanken der Welt in ihrem Kampf gegen die hohe Inflation auf gutem Weg zu sein scheinen.
Für das neue Jahr 2024 wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben das Beste, vor allen Dingen Gesundheit. Für das grosse Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, bedanken wir uns ganz herzlich und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!
Mit herzlichen Grüssen, im Namen des ganzen «Hotz-Teams», Ihr
Dr. Pirmin Hotz